
Interview mit Timothy Snyder
An die Wahrheit glauben alleine reicht nicht.
Timothy Snyder ist ein US-amerikanischer Professor und unterrichtet an der renommierten Yale-Universität. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Osteuropäische Geschichte und die Holocaustforschung, er hat mehrere vielbeachtete Publikationen in seinem Feld veröffentlicht und erhielt mehrfach Auszeichnungen für seine wissenschaftliche Arbeit. Sein 2017 erschienenes Buch "Über Tyrannei: 20 Lektionen für den Widerstand" stand auf der Bestsellerliste der New York Times und zeigt Wege auf, dem Niedergang der Demokratie im Angesicht des Ausgangs der US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen 2016 entgegenzuarbeiten. Sein aktuelles Buch "Der Weg in die Unfreiheit: Russland, Europa, Amerika" beschäftigt sich mit der Schwächung der westlichen Demokratien durch den Einfluss der Strategien des russischen Staatspräsidenten Vladimir Putin.
Grzegorz Nocko: Herr Snyder, wir beobachten aktuell einen zunehmenden Einfluss autoritärer Kräfte auf unsere Demokratien. Lässt sich für Sie als Historiker ein Moment der Konstituierung illiberaler Kräfte näher bestimmen? Inwieweit sind demokratische Institutionen für diese Entwicklung mitverantwortlich?
Timothy Snyder: Erstens: Wenn wir die Weltgeschichte seit den Babyloniern, Mesopotamiern oder Ägyptern anschauen, lässt sich beobachten, dass in der Geschichte nur ein kleiner Anteil der Menschen überhaupt in einem demokratischen System gelebt hat. Sprich: Demokratie als Regierungs- und Lebensform stellt eine Besonderheit dar. Zweitens denken wir, dass der gegenwärtige Globalisierungsprozess etwas Neues sei. Davon bin ich persönlich nicht überzeugt. Ich denke, dass die Globalisierung des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts in vielerlei Hinsicht mit heute vergleichbar ist: Die Bauwerke wie der Suezkanal und der Panamakanal, die Verbreitung des Telegramms und der Zeitung waren für die damaligen Gesellschaften äußerst prägend und transformativ. In gleicher Weise ähnelten die Herausforderungen des Liberalismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts dem, was wir heute erleben. Damit will ich sagen, dass Demokratie gewissermaßen fortlaufend herausgefordert wird. Wir sollten daher nicht überrascht sein, dass die Globalisierung heute eine Reihe spezifischer neuer Herausforderungen wie die Digitalisierung mit sich bringt. Zudem sind einige Sollbruchstellen in unseren Demokratien quasi von vornherein eingebaut.
Wir gehen davon aus, dass in einer kapitalistischen Gesellschaft der Kapitalismus notwendigerweise zu Demokratie führt.

Lassen wir die Geschichte beispielsweise im Jahr 1989 beginnen: Die damalige Beziehung zwischen Politik und Wirtschaft wurde durch Thatcherismus und Reaganismus geprägt und führte in Konsequenz zur Überzeugung, dass es zu diesen Modellen keine Alternativen gebe. Auch wenn wir in der Zeit nach vorne springen und uns das Russland von heute ansehen, gehen viele aktuelle Demokratie-Probleme dort auf die frühen 90er-Jahre zurück. Und nicht wenige haben damit zu tun, dass die Wirtschaft in gewisser Hinsicht automatisch auch die Politik verändert.
Die Frage, ob unsere demokratischen Institutionen für die Stärkung illiberaler Kräfte mitverantwortlich sind, muss man mit „Ja“ beantworten. Das hat teilweise mit der Vorstellung zu tun, dass die Zukunft nichts anderes sei als eine Weiterentwicklung des Gegenwärtigen ohne Alternativen. Das beschreibe ich ausführlich in meinem Buch „Der Weg in die Unfreiheit“ (Verlag C.H.Beck, 2018) mit dem Begriff „Politik der Unausweichlichkeit“. Die kapitalistische Variante der Amerikaner lautet, dass die Natur den Markt hervorgebracht hat und dann der Markt die Demokratie. In diesem Verständnis schafft der „Markt“ automatisch immer bessere Lebensbedingungen für alle. Diese faktenresistente Vorstellung ist aber nicht gut für unsere Demokratie: Wenn wir sagen, die geschichtliche Entwicklung sei zu Ende und es gibt keine Alternativen, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, aufkommende Probleme erkennen und entgegensteuern zu können.
Es ist dann auch weniger wahrscheinlich, dass wir wirtschaftliche Ungleichheit als ein generelles Problem erfassen. Wir gehen davon aus, dass in einer kapitalistischen Gesellschaft der Kapitalismus notwendigerweise zu Demokratie führt. Ebenso ist die Auffassung verbreitet, dass technologischer Fortschritt definitiv aufklärende Wirkung hat. Dabei kann sich herausstellen, dass Spitzentechnologie die Menschen „dümmer“ macht und die Demokratie verletzlicher. Wir müssen uns zu einer Mitverantwortung bei diesen Entwicklungen bekennen. Wenn wir dazu nicht fähig sind, können wir unsere Demokratie auch nicht in Ordnung bringen.
Beim Thema Mitverantwortung kommen wir auch auf einen zweiten Begriff, den ich in meinem Buch beschreibe: „Politik der Ewigkeit“. Darunter verstehe ich einen Zustand, in dem keiner – auch kein Politiker – verantwortlich für die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft zu sein scheint. Es herrscht die Überzeugung, dass Politik nicht helfen kann, sondern uns in erster Linie vor aktuellen Bedrohungen von außen schützt. Aber diese Politik lenkt ab und manipuliert. Sie bewegt sich in einem geschlossenen Kreis, in dem es keine zukunftsfähige Lösung gibt. Gesellschaftliches Zusammenleben wird dabei auf Gefühle und Emotionen reduziert. Dort gibt es keine Mitverantwortung.

Grzegorz Nocko: Liberale Demokratien bauen auf dem Prinzip des öffentlichen Diskurses und Konsensbildung auf. Sie definieren sich nicht nur durch die Institutionen, sondern vor allem prozessual im Zusammenleben. Es sollte also jederzeit möglich sein, kritisch und konstruktiv darüber zu diskutieren, wie eine Demokratie gelebt und ausgestaltet werden kann, ohne die Demokratie als System in Frage zu stellen. Doch dieser Kritik sind offenbar Grenzen gesetzt, sie wird in der Öffentlichkeit mitunter restriktiv behandelt. Wie ließe sich eine kritikfähige Demokratie vorstellen?
Timothy Snyder: Damit Demokratie funktioniert, müssen wir von der Annahme ausgehen, dass wir unterschiedliche Interessen, Meinungen und Werte haben. Ich bin Pluralist, ich denke es gibt viele gute Dinge in der Welt. Sie passen nur nicht alle in ein Bild. Es ist vernünftig, sich darüber zu streiten, was für unsere Gesellschaft wichtiger ist und was weniger. Das politische Leben erfordert einen ständigen Balanceakt zwischen unterschiedlichen Interessen. Und es geht dabei auch darum, neue Themen aufzunehmen. Hannah Arendt kommt immer wieder auf den Gedanken zurück, dass die Essenz der Freiheit eigentlich darin besteht, etwas Neues zu schaffen. In etwas anderer Weise schreib auch der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche, dass die Schaffung neuer Werte das Wichtigste sei. Neue Werte können nicht in einer Atmosphäre geschaffen werden, in der es auf alles nur eine einzige richtige Antwort gibt.
Der polnische Intellektuelle Krzysztof Czyżewski und seine polnischen Kollegen haben etwa das Argument vorgebracht, dass es gerade die Diskussionskultur war, die in den 90er-Jahren in Polen nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Systems versagt hat. Es fehlte eine Auseinandersetzung von Menschen mit unterschiedlichen Wertvorstellungen darüber, was gut und erstrebenswert sei. Die Demokratie muss bewusst Räume zur Verfügung stellen, in denen solche Diskussionen stattfinden können, selbst wenn sie zu nichts führen sollten. Wenn man denkt, dass Kapitalismus zwangsläufig zu Demokratie führen wird, dann fragt man nicht mehr danach, wofür Demokratie eigentlich gut ist. Man ist in dieser Logik gefangen.
Wären wir in einer idealen Welt, einem idealen Europa, so wären die Menschen in der Lage, Fragen über den Sinn Europas zu artikulieren, ohne damit sofort ein gemeinsames Europa in Frage zu stellen. Einer der Gründe, warum die Logik von Mittel und Zweck so attraktiv scheint, ist, dass sie den Menschen das Gefühl gibt, sie wüssten wohin sie gehen. In diesem Sinne ist die Art und Weise, wie Fragen an unsere Demokratie toleriert werden, autoritär. Als ob es nur einen Weg gäbe, den wir „Demokratie“ nennen. Bei Demokratie geht es, meiner Meinung nach, gerade um die unvorhersehbaren Fakten und auch um die unvorhersehbaren Werte. Wenn keine unvorhersehbaren Dinge mehr passieren, dann haben wir ein Problem mit unserer Demokratie.
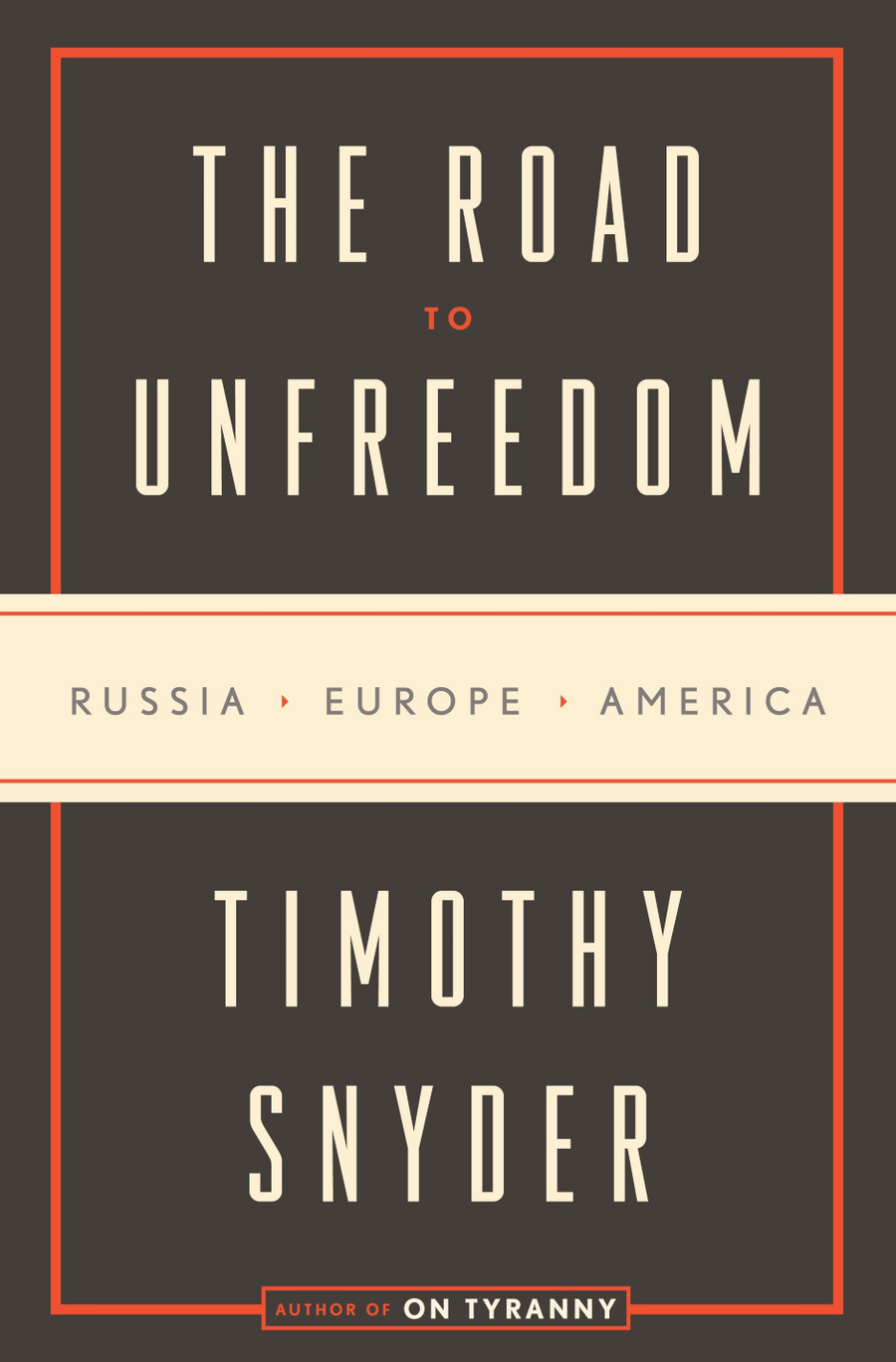
Grzegorz Nocko: In Ihrem letzten Buch „Der Weg in die Unfreiheit“ formulieren Sie im Epilog „Man sieht eine Welt zum ersten Mal, wenn man ihre Zerstörung erlebt.“ Wenn man diesen Gedanken auf das Phänomen des Populismus in Deutschland oder Europa überträgt: was ist in den letzten Jahren verloren gegangen?
Timothy Snyder: Danke für diese wichtige Frage. Jeder denkt, ich sei ein Pessimist, aber diese Aussage soll nicht pessimistisch sein. Der Hintergrund zu diesem Satz ist, dass wir aktuell eine Zeit erleben, in der wir mehr Freiheit besitzen dadurch, dass wir etwas verlieren. Und zwar verlieren wir eine gewisse Illusion darüber, dass die Art, wie wir bisher gelebt haben, gut ist bzw. war. Und die Frage ist, ob wir uns nun, da bestimmte Illusionen zerstört wurden, sofort wieder neue Illusionen machen wollen. Oder ob wir diesen kurzen Moment nutzen, um darüber nachzudenken, wie man bessere Demokratien errichten könnte. Ich glaube, dass dies in gewisser Weise eine Chance sein kann. Die Fehler der von uns bewunderten politischen Anführer zu sehen – das ist doch Demokratie! Es ist gut, zu sehen, dass Menschen – in guter Absicht – in den letzten dreißig Jahren einige grundlegende Fehler begangen haben. Denn es muss in der Demokratie um Lernerfahrungen gehen. Es kann nicht darum gehen, dass man immer recht hatte. Es muss in erster Linie ums Lernen gehen.
Grzegorz Nocko: Im gleichen Buch beschäftigen Sie sich auch mit Institutionen als Hüter von Werten und Tugenden. Sie schreiben: „Tugenden gehen aus den Institutionen hervor, die sie erstrebenswert und möglich machen. Wenn Institutionen zerstört werden, zeigen sich die Tugenden selbst.“ Könnten Sie den Zusammenhang zwischen „Institutionen“ und „Tugenden“ erläutern? Welches Licht wirft das auf die EU, ihre Institutionen und ihre Werte?
Timothy Snyder: Als Historiker finde ich Institutionen sehr interessant und wichtig. Und ich denke, dass es insbesondere für junge Menschen, denen Freiheit wichtig ist, von großer Bedeutung ist, sich daran zu erinnern, dass es beim Handeln für mehr Freiheit nicht darum geht, sämtliche Institutionen zu zerstören, um dann eine Lücke zu hinterlassen. Es geht darum, zwischen Institutionen zu wählen oder Institutionen aufzubauen, die es tatsächlich ermöglichen, frei zu sein. Es ist nicht möglich, allein frei zu sein. Und wenn wir einfach alle Institutionen, die wir haben, zerstören, werden wir damit nicht „die Macht“ oder die menschlichen Laster beseitigen. Wir sind in einer Situation, in der es immer Institutionen geben wird. Es stellt sich nur die Frage, welche besser und welche schlechter sind.
Was viele der Menschen, die ich bewundere, getan haben – und das entspring offensichtlich dem politischen Denken Polens und Osteuropas – viele dieser Menschen haben kleine Institutionen gegründet, die es anderen Menschen ermöglicht haben, frei zu leben. Es ist daher meines Erachtens nicht legitim, eine nationale Regierung oder die Europäische Union allgemein zu betrachten und zu sagen "Es handelt sich hier um eine Institution, und deswegen bin ich gegen sie“. Man muss ganz genau hinsehen, was diese Institution ermöglicht oder verhindert hat.
#Demokratiestärken
Die Stärkung der Demokratie in Deutschland und Europa ist einer der beiden Arbeitsbereiche der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Von Initiativen zur mehr Bürgerbeteiligung über digitale Wege der Demokratie bis hin zur international renommierten Hertie School of Governance in Berlin setzt sich die Hertie-Stiftung für dieses Anliegen ein.
Wenn man also die Europäische Union neu aufbaut, muss man sich, wenn es einem um Freiheit oder irgendeine andere Art von Gleichberechtigung geht, fragen: Wie kann ich eine Spur hinterlassen, die es wahrscheinlicher macht, dass diese Werte sich selbst reproduzieren? Wenn einem das wichtig ist, genügt es nicht zu sagen: Ich glaube an die Wahrheit. Man muss eine Art von Spur hinterlassen und diese kann lediglich aus den eigenen Handlungen bestehen. Es kann eine Zeitung sein, etwas, das man schreibt, die Art wie man mit anderen Menschen spricht. Ich denke, es muss einen positiven Dialog zwischen Werten und Institutionen geben, von links wie von rechts. Wissen Sie, diese netten linksgerichteten Anarchisten und diese mitunter sehr höflichen und sorgfältig frisierten rechtsgerichteten Liberalisten kommen beim Thema „Misstrauen gegenüber Institutionen“ irgendwie auf einen Nenner.
Es gibt diese Fantasie, dass wir nur die Institutionen abschaffen müssten, und dann würde sich das menschliche Verhalten irgendwie anpassen. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich denke, wenn man an einen bestimmten Wert glaubt, muss man versuchen, eine Art von Struktur um diesen Wert herum aufzubauen, auf jeder möglichen Ebene, auf der man dies tun kann. Ich glaube, dass man mit Blick auf die Zukunft der Demokratie aktiv über Werte nachdenken muss, darüber, was man wirklich für gut hält. Statt diese Verantwortung einfach auszublenden, indem man entweder sagt – ich bin immer im Recht, weil ich unschuldig bin – oder – ich bin immer im Recht, weil die Geschichte auf meiner Seite ist.
Grzegorz Nocko: Herr Snyder, ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch!
INFO Dr. Grzegorz Nocko ist Leiter des Berliner Büros der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung und Projektkoordinator von fellows & friends, dem Alumni-Programm der Hertie-Stiftung.

