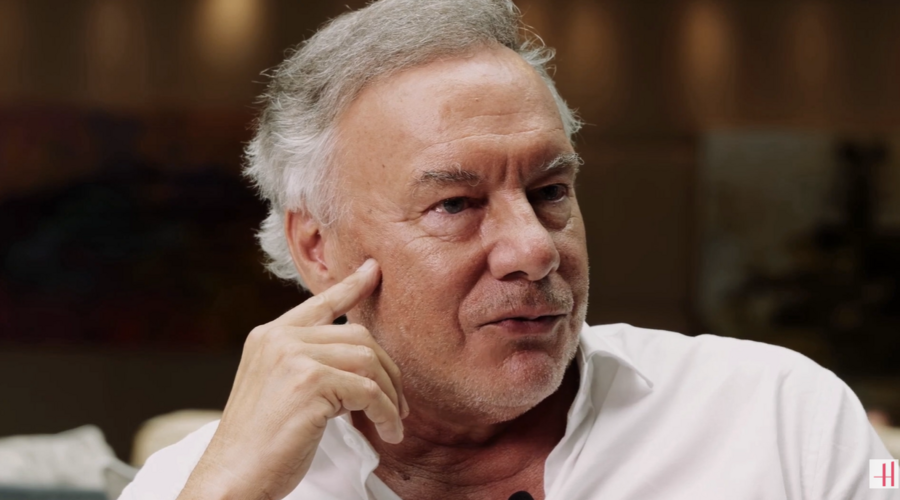Fonds für Antisemitismus-Bekämpfung und Aufklärung
Mit dem "Fonds für Antisemitismus-Bekämpfung und Aufklärung" fördert die Hertie-Stiftung über ihr bereits vorhandenes Engagement hinaus zusätzlich Projekte und Initiativen, die sich für die Erforschung und Bekämpfung des Antisemitismus und für jüdisches Leben in Deutschland einsetzen. Durch Unterstützung von Bildungs- und Dialogprojekten wollen wir zur Aufklärung und Stärkung der Gesellschaft und zu Toleranz beitragen.

Der "Fonds für Antisemitismus-Bekämpfung und Aufklärung" reflektiert unsere Haltung, die aus der historischen Verantwortung heraus entstanden ist. Die Geschichte der Gründerfamilie der Hertie-Warenhäuser, die unter dem Druck der Nationalsozialisten fliehen musste, erinnert uns stetig an die Notwendigkeit, Antisemitismus und Hass entschieden entgegenzutreten und jüdisches Leben in Deutschland zu schützen und zu fördern. Antisemitismus in seiner modernen Form ist kein Randphänomen und die Bekämpfung und Aufklärung ist eine dauerhafte Aufgabe.
Der Fonds unterstützt durch die Vergabe von Förderungen an gemeinnützige Körperschaften (z.B. Stiftungen, gGmbh, gUG) oder Körperschaften des öffentlichen Rechts vielfältige Projekte und Initiativen, die sich dem wachsenden Antisemitismus mutig entgegenstellen und aufklären. Gefördert werden vor allem innovative und wirksame Projekte, die junge Menschen erreichen wollen.
Die Handlungsfelder der Hertie-Stiftung sind dabei insbesondere Bildung und Prävention, Digitale Gegenstrategien, Förderung jüdischen Lebens, sowie Erinnerungskultur und Geschichtsbewusstsein. Beispiele für Förderungen und weitere Handlungsfelder im Feld der Antisemitismus-Bekämpfung und Aufklärung finden Sie weiter unten.
Durch den Fonds unterstützte Projekte nach Handlungsfeldern
Erinnern, Verstehen, Gestalten
Das Projekt „Erinnern, Verstehen, Gestalten“ des Vereins Bochumer Bildungszentrum richtet sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 10 bis 17 Jahren. Ziel ist es, sie für die Gefahren von Antisemitismus, Rassismus und anderen Formen von Diskriminierung zu sensibilisieren. Die Teilnehmenden lernen die Geschichte und aktuellen Erscheinungsformen von Antisemitismus kennen und setzen sich aktiv und kreativ mit dem Thema auseinander. In Workshops, zum Beispiel mit Kunst, Theater, Medien oder Sport, bringen die Jugendlichen ihre eigenen Erfahrungen ein und entwickeln gemeinsam neue Wege, um Hass und Vorurteilen zu begegnen. Das Projekt fördert das Verständnis für demokratische Werte wie Toleranz, Respekt und Solidarität und stärkt die Bereitschaft, Verantwortung für eine offene Gesellschaft zu übernehmen. Durch den Mix aus Wissen, kreativem Tun und persönlichem Austausch werden die Teilnehmenden gestärkt, selbst zu Botschafter*innen gegen Antisemitismus und Diskriminierung zu werden. So erfahren sie Demokratie und Toleranz nicht nur als Theorie, sondern als gelebte Werte, die sie im Alltag umsetzen können.
Widerstand gegen Antisemitismus: Kreative Methoden in Bildung und Kultur im NS-Dokumentationszentrum, Köln, und Forum VHS im Rautenstrauch-Joest-Museum
Die internationale Fachkonferenz des Jungen Theater Köln e.V. vereint Expertinnen aus Bildung, Wissenschaft, Theater und Community zur Analyse aktueller Erscheinungsformen des Antisemitismus und zur Entwicklung wirksamer Gegenstrategien. Im Fokus steht die Verbindung antisemitismuskritischer Bildung, forschungsbasierter Theaterarbeit und partizipativer Erinnerungskultur in NRW. Die Konferenz folgt einem intersektionalen, generationenübergreifenden und internationalen Ansatz und orientiert sich an den fünf Handlungsfeldern der Nationalen Strategie gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben (NASAS). Das Programm umfasst Impulsvorträge, Workshops, Diskussionen und Theateraufführungen zu Themen wie Social Media, Bildung und transgenerationale Traumata. Öffentliche Veranstaltungen fördern Begegnung und kulturellen Austausch. Angesichts des seit dem 7. Oktober 2023 zunehmenden Antisemitismus reagiert die Konferenz mit einem interdisziplinären Format, das Fachwissen, künstlerische Praxis und Pädagogik verbindet. Ziel ist es, jüdisches Leben sichtbar zu machen, Betroffenen eine Stimme zu geben und zentrale NASAS-Ziele in den Bereichen Bildung, Erinnerungskultur, digitale Räume und Sichtbarkeit umzusetzen.
Gegen Hass und Hetze – Antisemitismus und die Sozialen Medien
Mit den Schulprojekttagen „Gegen Hass und Hetze“ sensibilisiert die Stiftung für Engagement und Bildung e.V. bundesweit Schüler:innen für die Gefahren des modernen Antisemitismus – besonders in sozialen Medien. In interaktiven Workshops lernen Jugendliche, antisemitische Narrative zu erkennen, kritisch mit Informationen aus dem Netz umzugehen und sich aktiv gegen Hassbotschaften zu positionieren.
Das Projekt richtet sich insbesondere an Schulen in Ostdeutschland und schließt eine wichtige Lücke im Bereich digitaler Medienbildung und Antisemitismusprävention. Es verbindet historische Aufklärung mit aktuellen Erscheinungsformen antisemitischer Ideologien.Begleitend erhalten Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte praxisorientierte Fortbildungen, um Antisemitismus im Unterricht effektiv thematisieren zu können. Ziel ist es, Jugendliche zu stärken, Wissen über jüdisches Leben zu fördern und demokratische Werte zu festigen.
Buch trifft Podcast: Junges Hören – kluge Bücher
Das Aktive Museum Spiegelgasse in Wiesbaden startet ein innovatives Projekt: In kurzen Podcasts werden ausgewählte Bücher aus der vereinseigenen Bibliothek lebendig vorgestellt. Ziel ist es, besonders junge Menschen für jüdische Geschichte, Demokratie, Toleranz und Vielfalt zu begeistern – und sie zum Lesen anzuregen. Denn Bücher bieten Wissen, Empathie und Denkanstöße. Die fünfminütigen Audioformate, gesprochen von professionellen Sprecher*innen, setzen auf das beliebte Medium Podcast, um die Brücke zwischen analogem Lesen und digitalem Hören zu schlagen. Die vorgestellten Bücher sind direkt vor Ort ausleihbar – persönliche Gespräche mit dem Team inklusive. Das Projekt will nicht nur Interesse wecken, sondern nachhaltig wirken: Die Podcasts bleiben online verfügbar und können dauerhaft genutzt werden. Ein zukunftsweisendes Modell kultureller Vermittlung für ein junges Publikum – und ein aktiver Beitrag gegen das Vergessen und für eine lebendige Erinnerungskultur.
Holocaust Education und Antisemitismusprävention in der Grundschule
Das dreijährige Innovationsprojekt „Holocaust Education und Antisemitismusprävention in der Grundschule“ entwickelt ein Workshopkonzept für Viertklässler zur Geschichte des Nationalsozialismus und jüdischen Lebens. Ziel ist es, demokratische Werte zu stärken, Ausgrenzungsmechanismen zu erkennen und zivilcouragiertes Handeln zu fördern. Im Fokus stehen individuelle Lebensgeschichten jüdischer Kinder aus Leipzig, die durch visuelle Mittel wie Graphic Novels auch Kindern mit geringer Lesekompetenz zugänglich gemacht werden. Eine begleitende Workshop-Reihe für Jugendliche verbindet historisch-politische Bildung mit kreativer Gestaltung und stärkt ihre Selbstwirksamkeit. Die Ergebnisse sollen als Buch veröffentlicht werden und sind Teil der Erinnerungskultur. Zur Verbreitung des Konzepts sind ein Fachtag, eine Train-the-Trainer-Schulung sowie Fortbildungen und methodische Handreichungen für Lehrkräfte geplant. Das Projekt adressiert eine bislang wenig berücksichtigte Zielgruppe in der Antisemitismusprävention.
Elternforum Spezial der Katholischen Elternschaft Deutschland e.V. zu Thema Antisemitismus
Kurzbeschreibung Projekt: Bei dem letzten Bundeskongress der Katholischen Elternschaft Deutschlands in Paderborn, der ausschließlich dem Thema Antisemitismus gewidmet war, wurde die Entscheidung getroffen ein Elternforum Spezial zum Thema Antisemitismusbekämpfung zu veröffentlichen. Dieses umfasst Beiträge renommierter Autoren und einem umfangreichen Serviceteil, der schulische Gremien und insbesondere deren Elternvertreter befähigen soll, sich konstruktiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen und Lösungsansätze entwickeln. Die Publikation wird durch digitale Veranstaltungen für Eltern, Lehrerinnen und Lehrer begleitet. Dabei sollen praktische Handlungsmöglichkeiten zur Prävention und Konfliktbewältigung aufgezeigt werden. Zudem enthält das Spezialheft „Best-Practice-Beispiele, um die Akteure mit erfolgreichen Maßnahmen zu ermutigen, das Thema in den Fokus zu rücken.
Fortbildungsreihe: Gegen Antisemitismus, Antiziganismus und Ausgrenzung
Mit der Fortbildungsreihe „Gegen Antisemitismus, Antiziganismus und Ausgrenzung“ bietet die Stiftung VFS Führungskräften aus Profit- und Nonprofitbereichen praxisnahe Impulse, um Diskriminierung wirksam zu begegnen. In neun Modulen erhalten Teilnehmende fundiertes Wissen über historische und aktuelle Formen von Ausgrenzung sowie konkrete Werkzeuge für eine diskriminierungssensible Organisationskultur.
Die Themen reichen von Antisemitismus und Antiziganismus über Sprache und Vorurteile bis zu rechtlichen Rahmenbedingungen und Diversity-Strategien. Im Fokus steht die Entwicklung nachhaltiger Führungsansätze, die Vielfalt fördern und diskriminierenden Tendenzen frühzeitig entgegenwirken.
Durch ein Blended-Learning-Konzept mit Präsenz- und Onlineanteilen werden praxisnahe Inhalte vermittelt, die direkt in den Führungsalltag integriert werden können. Ziel ist es, über den beruflichen Kontext hinaus demokratische Werte zu stärken, neue Netzwerke zu knüpfen und ein klares Zeichen gegen Ausgrenzung zu setzen.
ASAF – Antisemitismuskritische Sensibilisierung an Film- und Medienhochschulen
Das Projekt ASAF der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF zielt auf die antisemitismuskritische Sensibilisierung in der Ausbildung an Film- und Medienhochschulen. Durch gezielte Bildungsmaßnahmen, Workshops und Öffentlichkeitsarbeit sollen Vorurteile abgebaut, Toleranz gefördert und das Bewusstsein für Antisemitismus gestärkt werden – insbesondere in gestalterischen, medial prägenden Berufsfeldern.
Im Zentrum stehen praxisnahe Formate für Studierende und Lehrende, die antisemitische Narrative erkennen, reflektieren und ihnen aktiv entgegentreten lernen. Parallel entsteht eine umfassende Dokumentation antisemitischer Vorfälle, um zukünftige Präventionsstrategien datenbasiert weiterzuentwickeln.
Das Projekt wird über zwei Jahre in Kooperation mit verschiedenen Partnerorganisationen realisiert. Es stärkt nicht nur die Ausbildung zukünftiger Medienschaffender, sondern unterstützt auch Betroffene antisemitischer Gewalt durch konkrete Angebote und sensibilisiert die Öffentlichkeit nachhaltig für demokratische und diskriminierungskritische Medienproduktion.
Das Haus der Frau L – Geschichte begehen, Erinnern erleben
Mit dem innovativen Projekt „Das Haus der Frau L“ eröffnet der Verein Geschichte Für Alle e.V. gemeinsam mit dem LOCI Kollektiv einen emotionalen und digitalen Zugang zur Erinnerungskultur. In einem interaktiven Video Walk erleben Schulklassen und Besucher:innen die kontrastierenden Lebensgeschichten zweier ehemaliger Bewohnerinnen einer Nürnberger Villa – der Jüdin Emilie Lob und der Anwältin Gabriele Lehmann.
Mittels QR-Codes, Smartphones und Kopfhörern werden die Teilnehmenden durch die Räume des Hauses geführt und tauchen in ein Jahrhundert deutscher Geschichte ein: Jüdisches Leben, Nationalsozialismus, Nachkriegsjustiz und Antisemitismus werden multiperspektivisch erzählt und mit aktuellen Fragen der Verantwortung und Teilhabe verknüpft.
Ziel ist es, jungen Menschen einen reflektierten Zugang zur Geschichte zu bieten, Antisemitismus zu erkennen und die eigene Rolle in Gesellschaft und Demokratie zu hinterfragen – an einem authentischen Ort, lebendig, persönlich und nachhaltig.
Schule des Lachens – Humor gegen Vorurteile
Mit dem Projekt „Schule des Lachens“ bringt die Dani Levy Stiftung Filme, Humor und Bildung zusammen: In einer einwöchigen Kinoreihe erleben Schüler:innen der Sekundarstufe II, wie Komödie als Werkzeug zur Auseinandersetzung mit Antisemitismus, Diskriminierung und gesellschaftlichem Zusammenleben wirken kann. Gezeigt werden sechs ausgewählte Filme – darunter Werke von Dani Levy, Charlie Chaplin oder Arman T. Riahi – begleitet von Unterrichtsmaterialien und abschließendem Filmgespräch mit Dani Levy.
Das Projekt fördert mediengestützte Reflexion und eröffnet interkulturelle Perspektiven: Jüdischer, muslimischer und politischer Humor werden in ihrer gesellschaftlichen Wirkung untersucht. Die Teilnehmenden lernen, wie Humor Identitäten formt, Stereotype entlarvt und Brücken zwischen Kulturen bauen kann.
„Schule des Lachens“ startet in Berlin mit dem Ziel, bundesweit ausgeweitet zu werden. Es stärkt kritisches Denken, kulturelle Teilhabe und das kreative Potenzial von Humor als Mittel gegen Ausgrenzung und Hass.
Kooperation:
Digital Holocaust Memorial – Erinnerung gestalten, Zukunft bewegen
Das Projekt „Digital Holocaust Memorial“ (DHM) bietet Jugendlichen eine zeitgemäße, partizipative Form der Auseinandersetzung mit der Shoah. Über eine digitale Plattform können Schüler:innen multimediale Beiträge – Texte, Bilder, Videos, Audio – zum Thema Holocaust erstellen, kommentieren und teilen. Der „digitale Erinnerungsraum“ wird dabei von Lehrkräften begleitet und moderiert.
Ziel ist es, Erinnerungskultur lebendig zu gestalten, Empathie und kritisches Denken zu fördern und Antisemitismus präventiv zu begegnen. Statt reiner Wissensvermittlung steht das dialogische Erinnern im Fokus: vielfältig, niedrigschwellig und offen für persönliche Zugänge.
Das Projekt startet an 15 Bildungseinrichtungen in Frankfurt und wird perspektivisch bundesweit ausgerollt. Es schafft eine dauerhafte, digitale Infrastruktur für historisch-politische Bildung – ergänzt durch wissenschaftliche Begleitung und Evaluation. DHM verbindet Geschichte, digitale Kompetenz und demokratische Teilhabe – und macht Shoah-Erinnerung zukunftsfähig.
Hackathon gegen Antisemitismus 2025 – Digitale Lösungen für eine demokratische Gesellschaft
Angesichts alarmierender Anstiege antisemitischer Vorfälle organisiert der Verein Ha-Kesher – Die Verbindung e.V. 2025 zum dritten Mal den Hackathon gegen Antisemitismus. Junge Teams aus ganz Deutschland sind eingeladen, innovative Projekte zu entwickeln, die digitale Bildung, Technik oder Kunst mit dem Ziel verbinden, Antisemitismus aufzuklären und ihm aktiv entgegenzuwirken.
Der Hackathon wird von einem Mentorinnenprogramm begleitet und kulminiert in einem intensiven, kreativen Projekttag. Die besten Konzepte werden in den Kategorien Bildung, IT und Kunst prämiert – neu dabei ist ein Sonderpreis für Schülerinnen. Wichtiger Fokus liegt auf Nachhaltigkeit und Umsetzbarkeit der Ideen.
Neben der Projektarbeit steht der Aufbau eines aktiven Netzwerks im Vordergrund: Teilnehmende vernetzen sich mit Bildung, Politik, Wirtschaft und Alumni früherer Hackathons. So entsteht eine wachsende Community junger Menschen, die Verantwortung übernehmen – gegen Antisemitismus und für eine starke Zivilgesellschaft.
Enkel Europas – Erinnern digital erleben
Das Projekt „Enkel Europas“ von genintelligence e.V. baut eine innovative digitale Plattform auf, die Zeitzeugnisse an historischen Orten digital erfahrbar macht. Durch intergenerationelle Zusammenarbeit zwischen jungen Menschen und Zeitzeug*innen entstehen interaktive Inhalte, die Geschichte lebendig vermitteln und zum Nachdenken über Antisemitismus, Rassismus und demokratische Werte anregen.
Herzstück des Projekts ist ein nutzerfreundliches Storytelling-Format, das gemeinsam mit Partnern wie Schulen, Young Caritas, Villa Vigoni und der LMU München entwickelt wird. Ziel ist es, eine aktive Community aufzubauen, die historische Verantwortung übernimmt und politische Bildung auf neue Weise denkt.
Die Plattform verknüpft digitale Medien mit persönlichen Geschichten und fördert so Beteiligung, Erinnerungskultur und gesellschaftlichen Dialog – gerade für eine junge, digitale Generation. Der offizielle Launch erfolgt bis Juni 2025, mit ersten Inhalten, Partnerschaften und partizipativen Formaten.
Erweiterung der Social Media Strategie des Jüdischen Museums Frankfurt
Das Jüdische Museum Frankfurt plant eine Social-Media-Offensive zur Vermittlung jüdischer Geschichte und Kultur sowie zur Bekämpfung von Antisemitismus. Das Vorhaben umfasst zwei zentrale Projekte: Erstens die Entwicklung eines digitalen Begriffslexikons mit Do’s und Don’ts für eine sachgerechte Sprache in der Darstellung jüdischer Geschichte. Dieses soll über den Instagram-Kanal des Museums (17.300 Follower) und den Blog (6.000 monatliche Views) veröffentlicht werden und Orientierung für Lehrkräfte, Multiplikator:innen und die interessierte Öffentlichkeit bieten. Zweitens sollen politisch-historische Kurzvideos über herausragende jüdische Persönlichkeiten (z. B. Familie Rothschild, Anne Frank) sowie zu jüdischen Festen und Traditionen produziert werden. Sie richten sich vor allem an Jugendliche auf TikTok und werden zusätzlich auf YouTube verbreitet. Eine junge jüdische Content-Creatorin wird hierfür als Gesicht des Museums wirken. Ziele sind die Aufklärung gegen Desinformation und antisemitische Klischees, die Erschließung neuer Zielgruppen und die Stärkung digitaler Bildungsarbeit.
Jüdische Netzakademie
Die Bildungsstätte Anne Frank e.V. in Frankfurt plant von Januar 2026 bis Mai 2027 das Pilotprojekt „Jüdische Netzakademie – Jüdische Positionen im Netz stärken“. Hintergrund ist der massive Anstieg von antisemitischen Narrativen und Hate Speech auf jugendrelevanten Plattformen wie TikTok, Instagram und YouTube – insbesondere seit den Ereignissen vom 7. Oktober 2023. Während bestehende Projekte vor allem die Mehrheitsgesellschaft sensibilisieren, setzt die Netzakademie bei den direkt Betroffenen an: jungen Jüdinnen und Juden, die antisemitischen Anfeindungen im Netz ausgesetzt sind und zugleich ihre Sichtbarkeit stärken möchten.
Das Projekt bietet Workshops und Trainings in vier Bereichen: Wissensvermittlung zu Antisemitismus und Algorithmen, Kompetenzaufbau und Resilienz, Professionalisierung des Social-Media-Auftritts sowie eine Content-Werkstatt für eigene Beiträge. Durch Kooperation mit jüdischen Influencer*innen und die Nutzung reichweitenstarker Kanäle der Bildungsstätte sollen jüdische Stimmen sichtbarer werden.
Kooperation:
Digital Holocaust Memorial – Erinnerung gestalten, Zukunft bewegen
Das Projekt „Digital Holocaust Memorial“ (DHM) bietet Jugendlichen eine zeitgemäße, partizipative Form der Auseinandersetzung mit der Shoah. Über eine digitale Plattform können Schüler:innen multimediale Beiträge – Texte, Bilder, Videos, Audio – zum Thema Holocaust erstellen, kommentieren und teilen. Der „digitale Erinnerungsraum“ wird dabei von Lehrkräften begleitet und moderiert.
Ziel ist es, Erinnerungskultur lebendig zu gestalten, Empathie und kritisches Denken zu fördern und Antisemitismus präventiv zu begegnen. Statt reiner Wissensvermittlung steht das dialogische Erinnern im Fokus: vielfältig, niedrigschwellig und offen für persönliche Zugänge.
Das Projekt startet an 15 Bildungseinrichtungen in Frankfurt und wird perspektivisch bundesweit ausgerollt. Es schafft eine dauerhafte, digitale Infrastruktur für historisch-politische Bildung – ergänzt durch wissenschaftliche Begleitung und Evaluation. DHM verbindet Geschichte, digitale Kompetenz und demokratische Teilhabe – und macht Shoah-Erinnerung zukunftsfähig.
Mehr auf der Projektseite erfahren
Kampagne in sozialen Medien in Planung mit Kooperationspartnern (z.B. Jüdisches Museum Frankfurt)
Jüdisches Lichterfest 2024 organisiert durch Chabad e.V.
Es handelt sich um eine Veranstaltung anlässlich des jüdischen Lichterfestes auf dem Vorplatz der Alten Oper in Frankfurt/Main. Der Kerzenleuchter "Chanukkiah" wird aufgestellt. Der Festakt beginnt mit dem Lichterzünden auf dem Opernplatz. Dazu wird es einen Ausschank geben sowie eine Musikbegleitung. Mit dem Lichterfest wird der Sieg der Makkabäer über die griechisch-syrische Fremdherrschaft im Jahre 164 vor Christus und die Wiedereinweihung des Jerusalemer Tempels gefeiert.
„Freiheit des Wortes – Wort der Freiheit“: Ausstellung zu Chatam Sofer
Die Ausstellung „Freiheit des Wortes – Wort der Freiheit“ in den Römerhallen Frankfurt (04.–14. Februar 2025) erinnert an das Leben und Wirken des weltberühmten Rabbiners Chatam Sofer (1762–1839). Geboren in Frankfurt, prägte er als Oberrabbiner in Pressburg (heute Bratislava) über drei Jahrzehnte hinweg das orthodoxe Judentum Europas. Die Schau beleuchtet seine Kindheit, Familie und Ausbildung, seinen Weg als Gelehrter und Lehrer sowie das geistige Erbe seiner berühmten Jeschiwa. Auch seine Grabstätte in Bratislava, die zur bedeutenden Gedenkstätte wurde, und das Grab seiner Mutter in Frankfurt stehen im Fokus. Die Ausstellung ist Teil eines deutsch-slowakischen Erinnerungsprojekts und verbindet religiöse Tradition mit europäischer Kulturgeschichte. Ziel ist es, das jüdische Erbe sichtbar zu machen und einen Beitrag zu Toleranz, Bildung und interkulturellem Dialog zu leisten – ein lebendiges Zeichen gegen das Vergessen.
Es existieren immense Lücken – Künstler*innen zwischen den Kulturen
Im Rahmen der Jüdischen Kulturwochen Frankfurt 2025 plant die Jüdische Gemeinde Frankfurt ein multimediales Theaterstück unter der Regie von Martha Kottwitz. Unter dem Arbeitstitel „Es existieren immense Lücken – Künstler*innen zwischen den Kulturen“ widmet sich die Produktion Exilbiografien jüdischer Künstlerinnen wie Erna Pinner und Emma Kann, die während der NS-Zeit aus Frankfurt fliehen mussten. Das Stück verarbeitet historische Dokumente, literarische Texte und Musik zu einer Bühnencollage, die Themen wie Heimat, Identität, Flucht und Neuanfang verknüpft. Zeichnungen Pinners und Gedichte Kanns werden in Bühnenbild und Text integriert, um die Brüche, Verluste und kreativen Weiterentwicklungen im Exil sichtbar zu machen. Neben der künstlerischen Darstellung sucht das Projekt den Austausch mit heutigen Geflüchteten und Künstler*innen im „Dazwischen“. Ziel ist es, historische Erfahrungen mit aktuellen Flucht- und Migrationserlebnissen in Beziehung zu setzen, Erinnerungskultur zu stärken und für gesellschaftliche Vielfalt sowie demokratische Verantwortung zu sensibilisieren.
Köfte Kosher 2025 – Jüdisch-muslimische Kulturbegegnung
Mit der Veranstaltungsreihe „Köfte Kosher 2025“ schafft der Kulturnetz e.V. einen lebendigen Raum für Begegnung, Erinnerung und kulturellen Austausch im Bremer Viertel. Am Marwa-El-Sherbini-Platz – benannt nach einem Opfer rassistischer Gewalt – wird eine Reihe von Veranstaltungen geplant, die sich insbesondere an Kinder und Jugendliche richtet.
Ziel ist es, über künstlerische Formate, kulinarische Impulse und gemeinsame Erlebnisse jüdische Kultur sichtbar zu machen und antisemitischen wie rassistischen Tendenzen aktiv entgegenzutreten. Die Veranstaltungsreihe versteht sich als Gegenentwurf zu den zunehmend gewaltverherrlichenden und polarisierenden Inhalten sozialer Medien.
Durch vielfältige, niedrigschwellige Angebote fördert das Projekt den interkulturellen Dialog und die gemeinsame Auseinandersetzung mit Erinnerungskultur, Alltagsrassismus und Antisemitismus. Im Zentrum stehen Empowerment, Teilhabe und die Vision einer solidarischen, diskriminierungsfreien Gesellschaft.
Offensichtliche Jüdinnen – Sichtbarkeit, Selbstbild, Stimme
Mit dem Projekt „Offensichtliche Jüdinnen“ porträtiert die Union progressiver Juden in Deutschland K.d.ö.R. jüdische Frauen in ihrer Vielfalt, Stärke und Selbstbestimmtheit. In Interviews erzählen sie von ihrem äußeren Erscheinungsbild, persönlichen Identitäten, religiösen Traditionen und gesellschaftlichen Erfahrungen. Diese Erzählungen werden künstlerisch visualisiert und soziologisch analysiert – als Kontrast zu klischeehaften Fremdzuschreibungen.
Ziel ist es, neue Bilder jüdischer Weiblichkeit zu schaffen, die im Gedächtnis bleiben – ehrlich, divers, lebendig. Daraus entsteht nicht nur eine künstlerisch-wissenschaftliche Porträtserie, sondern auch ein Bildungsangebot, das Dialogräume eröffnet und antisemitische Stereotype abbaut.
Das Projekt richtet sich an eine breite Öffentlichkeit und lädt zum Austausch auf Augenhöhe ein. Es stärkt die Identität jüdischer Frauen und fördert durch Kunst, Forschung und Bildung ein differenziertes Verständnis jüdischen Lebens in Deutschland – mit Mut zur Offenheit und Freude an gemeinsamer Zukunft.
Tachles – Antisemitismus verstehen, jüdisches Leben erleben
Mit dem bundesweiten Projekt „Tachles“ vermittelt die Deutsche Gesellschaft e. V. Schüler:innen ab der 9. Klasse fundiertes Wissen über Antisemitismus und macht gleichzeitig jüdisches Leben in Deutschland erfahrbar. In insgesamt 25 zweitägigen Workshops erleben die Teilnehmenden einen ganzheitlichen Ansatz: Am ersten Tag setzen sie sich mit den Ursachen, Formen und Auswirkungen antisemitischer Vorurteile auseinander. Am zweiten Tag lernen sie jüdische Kultur, Alltag, Traditionen und Vielfalt kennen – durch interaktive Stationenarbeit, Videos, Reflexionsphasen und kreative Methoden.
Das Projekt zielt darauf ab, Vorurteile abzubauen, Empathie zu fördern und Jugendliche zu befähigen, Antisemitismus aktiv entgegenzutreten. Besonderes Augenmerk liegt auf aktuellen Erscheinungsformen – z. B. im schulischen Umfeld oder auf Social Media – und auf der Förderung demokratischer Handlungskompetenz.
„Tachles“ schafft so Begegnung, Bewusstsein und Bildung – für eine offene Gesellschaft, in der jüdisches Leben selbstverständlich dazugehört.
Jüdische Perspektiven auf Antisemitismus: Eine Wanderausstellung
Die Wanderausstellung des Bundesverbands RIAS e.V. beleuchtet jüdische Perspektiven auf Antisemitismus in Deutschland nach 1945. Sie thematisiert nicht nur historische Ereignisse, sondern stellt auch die Erfahrungen und Stimmen jüdischer Menschen in den Mittelpunkt – von der Nachkriegszeit bis heute. Ziel ist es, Bewusstsein zu schaffen, Diskurse anzustoßen und einen Raum für Bildung, Austausch und Empathie zu eröffnen. Die Ausstellung wird professionell kuratiert, multimedial aufbereitet und durch eine Begleitbroschüre sowie eine eigene Website ergänzt. Sie richtet sich an ein breites Publikum und bietet durch Workshops, Vorträge und Diskussionsformate vielfältige Bildungsanlässe. Besonders im Fokus stehen die nachhaltige Nutzung der Materialien und die Anbindung an politische Bildungseinrichtungen. Mit dem Projekt will RIAS aktiv zur Bekämpfung von Antisemitismus beitragen – durch Sichtbarmachung jüdischer Stimmen und Ermutigung zum gesellschaftlichen Dialog. Die Eröffnung ist für 2026 geplant, gefördert durch Bund, Länder und die Bundeszentrale für politische Bildung.
Jüdisches Lichterfest 2025
Es handelt sich um eine Veranstaltung anlässlich des jüdischen Lichterfestes auf dem Vorplatz der Alten Oper in Frankfurt/Main. Der Kerzenleuchter "Chanukkiah" wird aufgestellt. Der Festakt beginnt mit dem Lichterzünden auf dem Opernplatz. Dazu wird es einen Ausschank geben sowie eine Musikbegleitung. Mit dem Lichterfest wird der Sieg der Makkabäer über die griechisch-syrische Fremdherrschaft im Jahre 164 vor Christus und die Wiedereinweihung des Jerusalemer Tempels gefeiert.
SUKKOT 2025 – Jüdisches Leben erleben und feiern in Chemnitz
Vom 5. bis 13. Oktober 2025 verwandelt sich der Chemnitzer Stadthallenpark in einen lebendigen Ort jüdischer Kultur, Begegnung und Gemeinschaft. Zwei Laubhütten – eine traditionelle der Jüdischen Gemeinde und eine kulturell-künstlerische mit dem Dagesh-Netzwerk – laden ein zu Dialog, Bildung und Feierlichkeiten rund um das jüdische Laubhüttenfest Sukkot.
Mit einem vielfältigen Programm aus Ausstellungen, Workshops, Konzerten, Theater, Lesungen, Kochkursen, interreligiösem Austausch und Erinnerungsarbeit schafft das Projekt Raum für Begegnungen auf Augenhöhe. Höhepunkte sind u.a. ein Gedenktag am 7. Oktober, Kreativangebote für Jugendliche, ein großes Musikfest und der feierliche Abschluss zu Simchat Tora.
SUKKOT 2025 richtet sich an alle Chemnitzer:innen und Gäste – generationsübergreifend, international, inklusiv. Gemeinsam mit zahlreichen Partnern aus Kultur, Bildung und Zivilgesellschaft wird jüdisches Leben sichtbar, erlebbar und Teil des städtischen Miteinanders gemacht.
Der gerettete Rest: Spurensuche einer verdrängten Geschichte
Der Dokumentarfilm „Der gerettete Rest“ beleuchtet die kaum bekannte Geschichte des Auschwitz-Überlebenden Samuel Danziger, der 1946 in Stuttgart von der Polizei erschossen wurde. Aus der Perspektive seines Enkels, der Jahrzehnte später die Hintergründe recherchiert, thematisiert der Film antisemitische Kontinuitäten, Schuldabwehr und die unzureichende Aufarbeitung in der Nachkriegszeit. Im Zentrum steht der Dialog zwischen dem Enkel und einer jungen Historikerin, die gemeinsam die damaligen Ereignisse rekonstruieren. Der Film richtet sich an ein breites Publikum und versteht sich als Beitrag zur politischen Bildung. Durch die Verbindung von individueller Erinnerung und gesellschaftlicher Analyse entsteht ein Werk mit hoher Relevanz für Bildungsformate und die Auseinandersetzung mit Antisemitismus heute. Premiere ist für 2025 geplant, flankiert von digitalen Ausstellungen und Fachtagungen. Ein Film gegen das Vergessen – und für einen generationenübergreifenden Diskurs über Verantwortung.
80 Jahre Befreiung aus dem Oflag VII A – Ausstellung & Zeitzeug*innengespräch
Zum 80. Jahrestag der Befreiung des Offiziersgefangenenlagers Oflag VII A in Murnau realisiert die Initiative Edut ein erinnerungspolitisches Projekt mit Ausstellung und Zeitzeug*innengespräch. Im Zentrum steht das Tagebuch des jüdisch-polnischen Offiziers Feliks Rzezcynski, der von 1939 bis 1945 in Murnau inhaftiert war. Seine persönlichen Aufzeichnungen, Briefe und Zeichnungen werden gemeinsam mit Originalmaterial des Marktarchivs öffentlich präsentiert.
Die Ausstellung beleuchtet ein weitgehend unbekanntes Kapitel regionaler NS-Geschichte und zeigt, wie die Shoah auch Orte wie Murnau prägte. In einem begleitenden Podiumsgespräch mit den Nachkommen Rzezcynskis wird über persönliche Verluste, Erinnerung und transgenerationelle Auswirkungen des Holocaust gesprochen – auch im Dialog mit Schüler:innen aus Murnau.
Ziel ist es, historisches Bewusstsein zu fördern, lokale Erinnerung zu stärken und junge Menschen für Antisemitismus und Ausgrenzung zu sensibilisieren – durch persönliche Geschichten, direkte Begegnung und lebendige Gedenkkultur.
TIKUN OLAM 2025 – Erinnern für die Zukunft
Das Projekt „TIKUN OLAM 2025“ des Vereins zur Förderung der Erinnerungskultur e.V. ist ein deutsch-italienisches Schüleraustauschprogramm, das Erinnerungskultur mit künstlerischer, historischer und psychologisch-transgenerationeller Arbeit verbindet. Vom 30. März bis 11. April 2025 kommen Jugendliche aus Berlin und Mailand zusammen, um sich gemeinsam mit der Geschichte des Holocaust, insbesondere dem Massaker am Lago Maggiore 1943, auseinanderzusetzen.
Zentrale Bestandteile des Projekts sind Workshops, Seminare und eine eigens komponierte Musikaufführung, die in beiden Städten öffentlich präsentiert wird. Ziel ist es, junge Menschen für Antisemitismus, Neofaschismus und Diskriminierung zu sensibilisieren und ihnen Raum für kreativen Ausdruck und kritische Reflexion zu geben. Ein begleitender Dokumentarfilm und die Ausbildung von „Zweitzeug:innen“ sichern die Nachhaltigkeit und Wirkung des Projekts.
„TIKUN OLAM“ versteht sich als Beitrag zu einer offenen, dialogorientierten und wachsamen Gesellschaft, in der Ausgrenzung keinen Platz hat.
Operation Finale – How to Catch a Nazi
Die Ausstellung „Operation Finale – Die Ergreifung und der Prozess von Adolf Eichmann“ beleuchtet die spektakuläre Verfolgung und Entführung eines der zentralen Organisatoren der Shoah. Entwickelt vom Maltz Museum in Zusammenarbeit mit dem Mossad und dem ANU Museum in Israel, wird die Schau 2025/26 im Filmmuseum Potsdam gezeigt – begleitet von Vorträgen, Filmen, Zeitzeug*innengesprächen und Bildungsformaten.
Ziel ist es, Jugendlichen einen emotional bewegenden Zugang zu NS-Geschichte, Antisemitismus und demokratischer Verantwortung zu eröffnen. Peer-Guides aus Oberstufenschüler*innen führen durch die Ausstellung und gestalten interaktive Bildungsangebote.
Nach großem Erfolg in München mit über 35.000 Besucher*innen, rechnet die Adolf Rosenberger gGmbH in Potsdam mit mehr als 50.000 Gästen. Unterstützt wird das Projekt u.a. von Günther Jauch, der Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz und dem Verein „Gegen Vergessen – Für Demokratie“.
Maries Vermächtnis – Film über Mut, Erinnerung und Widerstand
„Maries Vermächtnis“ ist ein dokumentarisches Filmprojekt über das Leben der jüdischen Unternehmerin und Stifterin Marie Eleonore Pfungst, die 1943 in Theresienstadt ermordet wurde. Der Film erzählt ihre Geschichte als Sinnbild für jüdisches Engagement, weibliche Selbstbestimmung und gesellschaftliche Verantwortung – damals wie heute.
Der Film verknüpft Maries Biografie mit der Erfolgsgeschichte der Naxos-Werke, dem historischen Erbe der Pfungst-Stiftung und aktuellen Fragen zu Antisemitismus und Erinnerungskultur. Mit animiertem Archivmaterial, Interviews und internationalen Schauplätzen – von Frankfurt bis zur Insel Naxos – entsteht ein eindrucksvolles Bild jüdischen Wirkens und Widerstands.
Geplant sind eine 30-minütige Bildungsfassung für Schulen sowie eine 70-minütige Kinoversion mit begleitender Social-Media-Kampagne. Ziel ist es, Geschichte greifbar zu machen, Antisemitismus entgegenzutreten und das Vermächtnis Marie Pfungsts lebendig zu halten – berührend, bildstark, bildend.
Film in der ARD-Mediathek ansehen
Gespräch von Nico Hofmann und Ina Knobloch ansehen
Drawn Together: Freundschaft im Angesicht des Holocaust
Drawn Together ist eine bilinguale Bilderbuch-Ausstellung, die ab Sommer 2025 als Pilotprojekt in der Gedenkstätte Bergen-Belsen gezeigt wird. Die Ausstellung richtet sich an Kinder ab 10 Jahren und beleuchtet auf einfühlsame Weise die Freundschaften jüdischer Kinder während des Holocaust. Gezeigt werden 18 ausgewählte Bilderbücher (englisch/deutsch), ergänzt durch kindgerechte, interaktive Materialien mit Informationen, Fragen und einer kreativen Abschlussaktivität. Ziel ist es, Antisemitismus früh zu begegnen, emotionale Zugänge zu schaffen und Werte wie Empathie, Freundschaft und Zivilcourage zu stärken. Die Ausstellung wird auch an der TU Braunschweig als Ressource für angehende Lehrkräfte genutzt, um Holocaust-Erziehung und Global Citizenship Education miteinander zu verbinden. Das Projekt verbindet emotionale Bildung mit inklusiven, sprachsensiblen Materialien und schafft so eine nachhaltige Plattform gegen Hass und Diskriminierung – in der analogen Ausstellung wie online.
Mehr Informationen auf der Website der TU Braunschweig
Orte des Erinnerns im alltäglichen Frankfurt
Das Pilotprojekt „Orte des Erinnerns im alltäglichen Frankfurt“ möchte Jugendlichen die jüdische Geschichte der Stadt durch digitale und ortsbezogene Zugänge erfahrbar machen. Im Mittelpunkt steht die Plattform Enkel Europas, die wie ein digitales Gedächtnis funktioniert. Hier werden Zeitzeugenberichte, Audiowalks, Videos und Texte genau dort verankert, wo sie historisch relevant sind – an Straßenecken, Schulwegen oder Orten der Verfolgung und des Mutes.
Die Jugendlichen recherchieren Orte jüdischen Lebens, arbeiten mit Zeitzeugen zusammen und entwickeln co-kreative Beiträge, die in Workshops journalistisch, künstlerisch oder dokumentarisch aufbereitet werden. Eine digitale Karte macht diese Inhalte öffentlich zugänglich und stärkt lokale Erinnerungskultur.
Mit wissenschaftlicher Begleitung der LMU München und technischer Umsetzung durch digitale Partner schafft das Projekt ein innovatives Bildungsformat, das Antisemitismus entgegenwirkt, Demokratiekompetenz fördert und auf andere Städte übertragbar ist.
Künstler*innen und die völkische Bewegung – Ein interdisziplinäres Forschungs- und Vermittlungsprojekt
Zum 100-jährigen Bestehen der Städtischen Galerie im Lenbachhaus initiiert das Museum gemeinsam mit dem NS-Dokumentationszentrum München ein Projekt, das die Rolle von Künstler*innen in der völkischen Bewegung des späten 19. Jahrhunderts kritisch untersucht. Im Zentrum steht Franz von Lenbach als Gründungsmitglied des Alldeutschen Verbands – und damit exemplarisch für die Verflechtung von Kunst, Politik und Ideologie.
Das Projekt kombiniert historische Forschung mit einem breit angelegten Rahmenprogramm aus Ausstellungen, Diskussionen, Bildungsformaten und künstlerischen Interventionen. Es macht ideologische Kontinuitäten sichtbar, schafft Raum für gesellschaftlichen Dialog und stellt Bezüge zu aktuellen rechtsextremen Entwicklungen her.
Ziel ist es, durch Wissen, Kreativität und Vielfalt der Normalisierung von völkischem Denken entgegenzutreten – und Perspektiven für eine offene, demokratische Gesellschaft zu stärken.