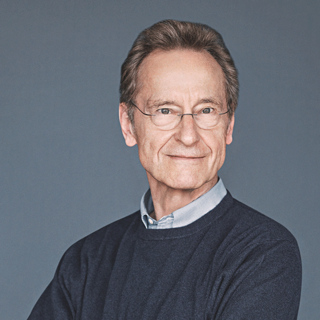Ein Gesellschaftsdienst für alle
Seit 2021 beschäftigt sich die Hertie-Stiftung mit der Einführung eines Gesellschaftsdienstes. Mit zwei wissenschaftlichen Studien trägt sie zur Versachlichung der Debatte bei. Ziel ist es, den Fokus der bisherigen politischen Initiativen auf konkrete Umsetzungsmöglichkeiten zu lenken, noch offene Fragen zu thematisieren und Gemeinsamkeiten der verschiedenen Modelle hervorzuheben.
Studie 2024
Wie kann ein Gesellschaftsdienst zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts beitragen?
Mit dieser Frage beschäftigt sich die zweite Machbarkeitsstudie der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung.
Im Kontext der aktuellen Debatte um eine mögliche Wehrpflicht oder einen Gesellschaftsdienst fasst die Studie den aktuellen Stand und die in Deutschland diskutierten Modelle zusammen. Das Fazit: Ein Gesellschaftsdienst, der den sozialen Zusammenhalt stärkt, ist machbar – und sollte nicht nur auf junge Menschen nach dem Schulabschluss abzielen. Beispiele aus anderen europäischen Ländern zeigen die Chancen und die Komplexität dieser Aufgabe.
Die Studie betont, dass ein klarer Rahmen, bedarfsorientierte Aufgaben und ein nachhaltiger gesellschaftlicher Mehrwert entscheidend sind, um Akzeptanz für dieses Vorhaben zu schaffen und die nächsten Schritte zur Umsetzung zu gehen.
Studie 2023
Die Studie 2023 „Ein Gesellschaftsdienst für alle – zur Machbarkeit in Deutschland und Europa“ untersucht, wie ein Gesellschaftsdienst zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts beitragen kann. Dabei liegt der Fokus nicht auf der Frage, ob dieser Dienst verpflichtend oder freiwillig sein sollte, sondern darauf, wie er unter den aktuellen Rahmenbedingungen attraktiv gestaltet werden kann. So bietet die Studie konkrete Handlungsempfehlungen, um einen Gesellschaftsdienst für verschiedene Zielgruppen ansprechender zu machen und gleichzeitig einen positiven Beitrag zum gesellschaftlichen Miteinander zu leisten.
Zentrale Aspekte für die Umsetzung eines Gesellschaftsdienstes
Ein moderner Gesellschaftsdienst benötigt eine digitale Infrastruktur mit minimalem Verwaltungsaufwand. Zentrales Matching ermöglicht eine schnelle Vermittlung von Interessierten zu passenden Aufgaben. Eine frühzeitige digitale Registrierung erleichtert den Einstieg.
Qualifizierungsmaßnahmen sollten teilweise digital und hybrid erfolgen, um Flexibilität zu bieten und die Ausbildenden zu entlasten. Dadurch bleiben Teilnehmer auch nach dem Dienst als Reservisten im System.
Anrechnungen als Fortbildung oder 10. Schuljahr sind besonders attraktiv für Menschen mit niedriger Qualifikation. Eine anerkannte Dachmarke und passende Dienstformate für verschiedene Lebenslagen sind notwendig, ebenso wie Anreize wie z.B. eine „Gesellschaftszeit“.
Menschen benötigen mehrfach im Leben Anknüpfungspunkte, um Teil des Dienstes zu werden. Bestehende Interaktionen wie Passverlängerungen oder Wahlbenachrichtigungen können genutzt werden, um viele Menschen regelmäßig zu erreichen.
Der Dienst muss kontinuierlich weiterentwickelt werden, um seine Relevanz zu sichern. Tätigkeitsfelder und Einsatzmodelle sollten ständig an die Bedürfnisse der Gemeinschaft und der Teilnehmenden angepasst werden. Lang- und Kurzzeitstudien zur Evaluation sind von Beginn an erforderlich.
Europäische Zusammenarbeit sollte fester Bestandteil der Debatte sein. Der Austausch guter Modelle und die Entwicklung gemeinsamer Ansätze fördern den europäischen Zusammenhalt und setzen ein Zeichen gegen nationalistische Tendenzen.
Aktuelle Entwicklungen in Europa und der Welt
Initiatoren der Studie

Prof. Nico Hofmann

Dr. h.c. Frank-J. Weise

Prof. Dr. Bernhard Schlink
Autorenteam

Dr. Rabea Haß

Dr. Grzegorz Nocko
Videointerviews
In sechs Videointerviews berichten Menschen diverser Alter über Ihre Erfahrungen mit und Ihre Perspektive auf einen Gesellschaftsdienst. So spricht etwa Prof. Dr. Bernhard Schlink, Jurist, Schriftsteller und Mitinitiator der Hertie-Studie, über die seiner Meinung nach positiven Auswirkungen eines Dienstes auf Gesellschaft und Individuum. Während Nelly Schrader, Mitbegründerin der Kampagne "Freiwilligendienst Stärken", über die ihrer Ansicht nach mangelnde Bekanntheit eines Gesellschaftsdienstes unter jungen Menschen berichtet.
Sie möchten mehr erfahren?
Wenn Sie als Journalistin, Politiker oder Forschende mehr über die Machbarkeitsstudie zum Gesellschaftsdienst erfahren möchten, nehmen Sie gerne mit Elisabeth Niejahr Kontakt auf. Wir versorgen Sie mit Hintergrundinformationen oder vermitteln Ihnen Gesprächspartner zum Thema.