
Interview mit Dr. Ulrike Hedrich-Klimosch
Menschen mit seltenen Erkrankungen sollen wissen, dass wir Forschenden sie nicht vergessen.
Am 28. Februar ist der Tag der Seltenen Erkrankungen. Weltweit soll dieses Datum auf die Sorgen und Nöte der Menschen aufmerksam machen, die an einer sogenannten seltenen Erkrankung leiden. Das ist der Fall, wenn höchstens einer von 2.000 Erwachsenen und auch Kindern betroffen ist. Obwohl das wenig klingt, leiden allein in Deutschland etwa 4 Millionen Menschen an einer seltenen Erkrankung, die oft chronisch und lebensverkürzend sein kann. Die Betroffenen haben mit vielen Belastungen zu kämpfen: Es gibt kaum Therapien oder Medikamente, und der Weg zur Diagnose ist für viele eine Odyssee. Doch jetzt ist es dem Team um Dr. Ulrike Hedrich-Klimosch und Prof. Holger Lerche von der Abteilung Neurologie mit Schwerpunkt Epileptologie am Hertie-Institut für klinische Hirnforschung (HIH) in Tübingen gelungen, eine Arzneitherapie für eine seltene Form der frühkindlichen Epilepsie zu entwickeln - mit einem Medikament, das eigentlich gegen Multiple Sklerose (MS) im Einsatz ist. Wie die mit dem Eva Luise Köhler Forschungspreis für Seltene Erkrankungen ausgezeichnete Diplom-Biologin und ihre Kollegen auf diese Entdeckung kamen, was die Forschung an seltenen Erkrankungen so herausfordernd macht, und welche Aussicht es auf neue Therapien gibt, erläutert Dr. Hedrich-Klimosch in unserem Interview.
Sie haben erstmals eine Arzneitherapie für eine seltene Form der frühkindlichen Epilepsie entwickeln können. Was ist das für eine Erkrankung?
Bei dieser genetisch bedingten Form der Epilepsie leiden die Betroffenen bereits im ersten Lebensjahr an schweren epileptischen Anfällen, die Entwicklungsstörungen auslösen: Es fällt den Kindern schwer zu laufen, sie können sich schlecht konzentrieren und haben später Probleme beim Rechnen, Sprechen und Buchstabieren. Ursache ist ein Gendefekt, in unserem Fall ist es eine Mutation im KCNA2-Gen, die zu geschädigten Kaliumkanälen im Gehirn führt. Kaliumkanäle sind kleine Poren, die in der Zellmembran von Nervenzellen sitzen, und für die Weiterleitung elektrischer Signale wichtig sind. Durch den Gendefekt kommt es zu einer Überaktivität der Kaliumkanäle und schließlich zu den beschriebenen Krankheitssymptomen.
"Ich denke schon, dass der Gentherapie die Zukunft gehört, und wir setzten große Hoffnung darauf, dass sie bei vielen Erkrankungen erfolgreich eingesetzt werden kann, aber das wird noch dauern. "
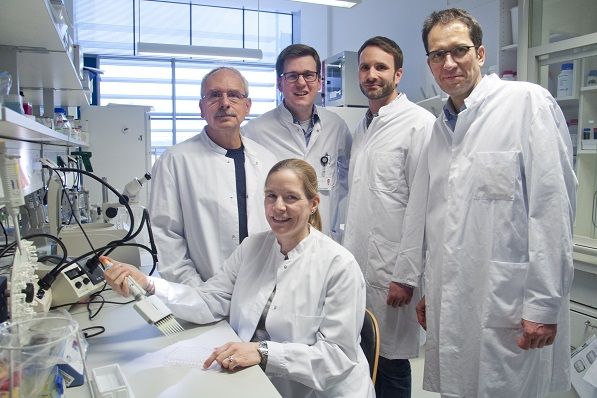
Wie viele Menschen sind von dieser Mutation betroffen?
Uns sind weltweit etwa 60 Fälle bekannt, die Mutationen im KCNA2-Gen tragen. Wobei es sich nicht nur um Kinder handelt, sondern auch um Erwachsene, bei denen die Krankheit erst später diagnostiziert wurde. Sie litten schon lange unter den Symptomen, aber erst der technische Fortschritt machte eine Diagnose möglich. In Deutschland sind uns weniger als 10 Menschen bekannt, die von Mutationen in diesem Gen betroffen sind.
Sie haben entdeckt, dass ein MS-Medikament gegen diese Epilepsieform erfolgreich die Symptome lindern kann. Wie kam es dazu?
Unsere Kollaborationspartner aus Leipzig haben die ersten Mutationen im KCNA2-Gen bei Patientinnen und Patienten identifiziert. Wir haben daraufhin die unterschiedlichen Mutationen dieses Gens charakterisiert und konnten feststellen, dass bei einigen Erkrankten eine Unterfunktion des Kaliumkanals und bei anderen eine Überfunktion vorliegt, die aufgrund von Mutationen in diesem Gen hervorgerufen werden, und konnten dies 2015 zusammen publizieren. Dann haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir diese Patienten behandeln könnten. Es gibt Kaliumkanalblocker, die relativ spezifisch wirken, und zu denen eben auch ein Medikament gehört, das bei Gangstörungen bei Patienten mit Multipler Sklerose zugelassen ist.
Wie ging es dann weiter?
Zunächst haben wir dieses MS-Medikament auf Froscheiern, mit denen wir diese Mutation vorab charakterisiert hatten, getestet. Wir konnten sehen, dass sich die Eigenschaften der Kaliumkanäle so verändern können, dass wieder ein gesundes Level erreicht werden kann. Dann haben wir in Kooperation mit acht Zentren weltweit begonnen, elf Patientinnen und Patienten in individuellen Heilversuchen zu behandeln. Mit Erfolg: Bei neun von ihnen verbesserten sich die Symptome. Die Anzahl der täglichen epileptischen Anfälle reduzierte sich oder verschwand komplett. Die Betroffenen waren im Alltag allgemein deutlich wacher und geistig fitter. Auch ihre Sprache verbesserte sich nach Beginn der Medikamentenbehandlung.
Das Stichwort ist hier „Drug-Repurposing“, also die „Zweckentfremdung“ eines zugelassenen Medikamentes zur Behandlung einer gängigen Erkrankung, um eine seltene Erkrankung zu kurieren. Hat diese kleine Patientengruppe eigentlich eine Chance auf Forschung für eigene Therapien?
Eher nicht. Für seltene Erkrankungen ist es schwierig, eigene Medikamente zu entwickeln, weil es für die großen Pharmaunternehmen zu teuer und damit nicht interessant ist. Man bräuchte für die Entwicklung auch klinische Studien, und das ist bei der geringen Zahl an Patienten mit seltenen Erkrankungen, die auch noch in unterschiedlichen Ländern leben, sehr schwierig. Ein guter Kompromiss, um möglich rasch zu einer möglichen Therapie zu kommen, ist deshalb, Medikamente zu nutzen, die bereits für andere Indikationen zugelassen sind.
"ich würde mir wünschen, dass Patienten mit seltenen Erkrankungen von ihren Ärzten an die Spezialisten an den Universitätskliniken überwiesen werden."
Rund 80 Prozent der seltenen Erkrankungen sind genetisch bedingt. Wie sieht es mit dem Einsatz der sogenannten Genschere aus, mit der defektes Erbgut verändert werden kann?
Dafür ist es noch zu früh. Es wird noch lange dauern, bis diese Möglichkeit erfolgreich bei unseren Patientinnen und Patienten eingesetzt werden kann. Ich denke schon, dass der Gentherapie die Zukunft gehört, und wir setzten große Hoffnung darauf, dass sie bei vielen Erkrankungen erfolgreich eingesetzt werden kann, aber das wird noch dauern.
Sie arbeiten in der Abteilung Epileptologie. War das Zufall, dass mit der KCNA2-Mutation eine seltene Erkrankung auf Ihrem Tisch gelandet ist, oder sind die so genannten „Waisen der Medizin“ Schwerpunkt Ihrer Forschung?
Da ich hauptsächlich an genetischen Epilepsien oder auch an genetisch bedingter Migräne forsche, sind die Symptome, an denen wir arbeiten, alle ziemlich selten. Von daher ist es für mich normal, mit Mutationen zu arbeiten, die nur bei wenigen Menschen vorkommen. Das gilt zum Beispiel auch für das seltene Dravet-Syndrom, einer weiteren frühkindlichen Form der Epilepsie. Mit zwei Kolleginnen vom Centrum für Integrative Neurowissenschaften (CIN) und dem Physiologischen Institut in Tübingen habe ich dazu ein Forschungsprojekt, für das wir nun die Förderung der Gruppo Famiglie Dravet Associazione ONLUS in Partnerschaft mit anderen europäischen Dravet-Stiftungen bekommen haben, die sich aus Eltern betroffener Kinder zusammengeschlossen hat. Auf diese Arbeit freue ich mich sehr.
Was ist für Sie persönlich die größte Herausforderung bei der Erforschung seltener Erkrankungen?
Auf eine Behandlungsmethode zu kommen! Wenn wir neue Gendefekte ins Labor bekommen, ist die Untersuchung gar nicht das Problem: Wir können defekte Kanäle messen und versuchen, den Mechanismus zu verstehen. Aber wie wir daraus eine Therapie entwickeln können, ist nicht so einfach, da muss man sich wirklich Gedanken machen: Gibt es eventuell Medikamente, die schon bekannt sind, und die spezifisch auf diese Kanäle wirken? Was bewirkt der defekte Kanal eigentlich in unserem Gehirn? Das ist ein großer Schritt, und es sind viele Untersuchungen nötig, bis es zu einer echten Therapieoption kommt.
Stichwort Translation, also der Weg der Forschung aus dem Labor in die Klinik zum Patienten: Haben Sie generell den Eindruck, dass Forschungsergebnisse umgehend am Klinikbett landen?
Die Zusammenarbeit am HIH ist da wirklich genial. Das Zusammenspiel von Klinkern und Labor funktioniert hier sehr gut. Da gelangt vieles, was wir im Labor machen, in die Klinik. Aber ich denke, dass das leider noch nicht überall der Fall ist.
Hertie-INSTITUT
Mehr Information zur Forschung von Dr. Ulrike Hedrich-Klimosch und zu weiteren neurowissenschaftlichen Forschungsbereichen gibt es auf der Website des Hertie-Instituts für klinische Hirnforschung.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft, wenn es um die Erforschung seltener Erkrankungen geht?
Mich würde es freuen, wenn Studien, in denen Gene erkannt und neue Behandlungsmethoden beschrieben werden, möglichst breit publik gemacht würden. Damit die Patientinnen und Patienten sehen, dass es Fortschritte und Möglichkeiten gibt, die vielleicht auch ihnen helfen können. Sie sollen wissen, dass wir Forschenden sie nicht vergessen. Und ich würde mir wünschen, dass Patienten mit seltenen Erkrankungen ernst genommen werden: Dass sie von ihren Ärzten an die Spezialisten an den Universitätskliniken überwiesen werden, wo es große Zentren gibt, die sich nur mit diesem Thema befassen. Oder, dass sich die Betroffenen auch selbst an die Zentren wenden. Da eignet sich so ein Tag der Seltenen Erkrankungen natürlich perfekt, um darüber zu informieren.
INFO Das Interview führte Rena Beeg für die Gemeinnützige Hertie-Stiftung

