MS-Forschung
Unser Engagement im Bereich der MS-Forschung
MS-Forschung. Die Hertie-Stiftung fördert über medMS Ärztinnen und Ärzte sowie Doktorandinnen und Doktoranden in ihrer Forschung an der Erkrankung Multiple Sklerose.
medMS-Doktorandenprogramm
Mit dem Doktorandenprogramm möchten wir exzellente, wissenschaftlich interessierte Medizinstudierende motivieren, sich in ihrer Dissertation auf das Thema Multiple Sklerose zu konzentrieren.
Hauptförderung ist ein 12-monatiges Stipendium während der praktischen Phase der Promotion, in dem das Medizinstudium für mindestens sechs Monate zugunsten der vollzeitlichen Tätigkeit für die Dissertation unterbrochen wird. Die betreuende Person der Arbeit erhält einen Sachmittelzuschuss in Höhe von 5.000 Euro.
In Zusammenarbeit mit dem Hertie-Netzwerk fellows & friends treffen sich die geförderten Doktorandinnen und Doktoranden regelmäßig (auch über die Zeit des Stipendiums hinaus) zum wissenschaftlichen Austausch. Zur Förderung gehört zudem der Besuch des Welt-MS-Kongresses ECTRIMS und einer Summer School. Herausragende Arbeiten werden mit einem Preis belohnt.
Weitere Informationen finden Sie in der Infobox zur Ausschreibung.
Unterstützte Doktoranden
Angegeben sind jeweils das Jahr der Projektbewilligung und die antragstellende Person.
Sommersemester
Emil Pril
Universitätsmedizin Rostock
Protektive Eigenschaften der Sphingosin-1-Phosphat Signalkaskade im Multiple Sklerose Tiermodell
(Doktorvater: Markus Kipp)
Jan Philipp Mügge
Universitätsklinikum Münster
Analyse von altersbedingten Veränderungen von Phänotyp und Funktion von Mikrogliazellen und ihrer Relevanz für die Progression bei der Multiplen Sklerose
(Doktormutter: Luisa Klotz)
Maryam Elisabeth Yahyawi
Charité – Universitätsmedizin Berlin
Neuroimaging des dynamischen Lymphabflusses bei MS, NMOSD und MOGAD
(Doktorvater: Friedemann Paul)
Freya Louise Hesse
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Das sportinduzierte Myokin Irisin als potentielle neuroprotektive Therapie bei der Multiplen Sklerose
(Doktormutter: Sina Cathérine Rosenkranz)
Paul Götz
Universitätsmedizin Mainz
Charakterisierung von B Zell vermittelten neuronalen Schadensmechanismen und deren Modulation durch Inhibition der Bruton-Tyrosinkinase
(Doktormutter: Frauke Zipp)
Sommersemester
Wencke Lara Gräßner
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden
Evaluation pharmakokinetischer sowie pharmakodynamischer Parameter nach der Umstellung der intravenösen auf die subkutane Applikation von Natalizumab und der Korrelation zu Biomarkern
(Doktormutter: Katja Akgün)
Dorian Kock
Philipps-Universität Marburg
Neuro- und immunmodulatorische Effekte der transkutanen Vagusnervstimulation bei Patient*innen mit Multipler Sklerose und Depressionen
(Doktorvater: Felix P. Bernhard)
Johannes Wittig
Universitätsmedizin Mainz
Translatom-Analyse neurodegenerativer Signalwege vulnerabler Neuronenpopulationen in der Multiplen Sklerose
(Doktorvater: Stefan Bittner)
Ionel Busuiocescu
Charité – Universitätsmedizin Berlin
Untersuchung der zirkadianen Alterung von Neutrophilen in NMOSD
(Doktormutter: Carmen Infante-Duarte)
Poul Schulte-Frankenfeld
Charité – Universitätsmedizin Berlin
Proteomweites Antikörper-Profiling bei der Multiplen Sklerose und ihren Differentialdiagnosen
(Doktorvater: Schülke-Gerstenfeld)
Wintersemester
Farzeen Foiz
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Antikörperfragmente als Gentherapie in der Multiplen Sklerose
(Doktorvater: Manuel Friese)
Elisa Wolfanger
Center for Integrative Physiology and Molecular Medicine
Die Rolle der geschlechtsspezifischen GABAB-Rezeptor-Signalgebung in Oligodendrozyten Vorläuferzellen während der Remyelinisierung im Mausmodell der Multiplen Sklerose
(Doktorvater: Frank Kirchhoff)
Luca Magdalena Manthey
Charité – Universitätsmedizin Berlin
Prädiktion schubunabhängiger Krankheitsprogression in Aquaporin-4-Antikörper-seropositiver Neuromyelitis optica
(Doktormutter: Frederike Oertel)
Tim Zwinscher
Universitätsmedizin Mainz
shRNA based therapy targeting ICOS-L for Alleviating Neuroinflammatory Burden in Autoimmune Encephalomyelitis
(Doktorvater: Ari Waisman)
Christina Jansen
Carl von Ossietzky Universität
Kognitive Störungen bei Multipler Sklerose: Objektivierung von Accelerated long term forgetting mithilfe neuropsychologischer Testverfahren bei einem breiten Patientenkollektiv
(Doktorvater: Karsten Witt)
Sommersemester
Andre Braginets
Charité - Universitätsmedizin Berlin, Experimental and Clinical Research Center – ECRC
Die Netzhautatrophie als Imaging-Biomarker für Krankheitsprogression bei schubförmiger Multipler Sklerose
(Doktormutter: Hanna Zimmermann)
Charlene Damp
Charité - Universitätsmedizin Berlin, Experimental and Clinical Research Center – ECRC
Untersuchungen zu neuartigen Therapien mit Magnet Resonanz-(MR) Reporter Aktivität im Multiple-Sklerose-Mausmodell
(Doktormutter: Sonia Waiczies)
Sevil Guifar
Justus-Liebig-Universität Gießen, Medizinisches Zentrum für Neurologie und Neurochirurgie
Effekte des FGFR1-Knockouts in Bezug auf Entzündung und Degeneration in der MOG35-55 induzierten EAE im Hirnstamm
(Doktorvater: Martin Berghoff)
Gesche Herold
Charité - Universitätsmedizin Berlin, Experimental and Clinical Research Center – ECRC, Neuroimmunologie-Labor
Charakterisierung der Lymphozytensubpopulationen im Liquor in der Differentialdiagnostik der Multiplen Sklerose
(Doktorvater: Volker Siffrin)
Laura Wirsching
Technische Universität München, Klinik für Neurologie
Liquorzellpopulationen bei Personen mit Multipler Sklerose – Assoziation zum klinischen Verlauf und genetische Einflussfaktoren
(Doktormutter: Christiane Gasperi)
Wintersemester
Darwin Nagel
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Beschleunigtes neuronales Altern - Inflammaging - bei der Multiplen Sklerose
(Doktorvater: Manuel A. Friese)
Lina Dümmer
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
READY for MS – Entwicklung eines Onlineprogramms zur Förderung der Resilienz bei MS
(Doktorvater: Christoph Heesen)
Anastasiia Sydorenko
Ludwig-Maximilians-Universität München
Untersuchung der Rolle von Gasdermin D und E bei der axonalen Degeneration im Mausmodell der Multiplen Sklerose
(Doktorvater: Martin Kerschensteiner)
Hanna Zdiarstek
Universitätsmedizin Göttingen
Schädigung der Hirnrinde bei multipler Sklerose – auf der Suche nach molekularen Checkpoints für die progrediente, neurodegenerative Verlaufsform
(Doktormutter: Christine Stadelmann-Nessler)
Julian Scheuren
Universitätsmedizin Mainz
GPVI-abhängige Modulation der Thrombozytenfunk4on zur Beeinflussung neuroinflammatorischer Prozesse und Immunzellantwort in der experimentellen autoimmunen Enzephali4s (EAE)
(Doktorvater: Timo Uphaus)
Wintersemester
Maximilian Anschlag
Universität Hamburg, Neuroimmunologie und MS
Entstehung und Zusammensetzung neurotoxischer Aggregate des präsynaptischen Proteins Bassoon in der Multiplen Sklerose
(Doktorvater: Manuel Friese)
Johann Krüger
Universität Rostock, Institut für Anatomie
Untersuchung des Sphingosin-1-Rezeptors, Subtyp 5 im Multiple-Sklerose-Tiermodell
(Doktorvater: Markus Kipp)
Luca Fehrenbacher
Universität Freiburg, Institut für Neuropathologie
Myeloische Zellen bei demyelinisierenden ZNS-Erkrankungen: Von der Einzelzellsequenzierung zur vergleichenden Pathophysiologie
(Doktorvater: Marco Prinz)
Daniel Farrenkopf
Universität Erlangen, Neurologische Klinik
Untersuchung eines AHR-Liganden-produzierenden Probiotikums in einem Mausmodell der Multiplen Sklerose
(Doktorvater: Veit Rothammer)
Sophie Stichert
Universität Heidelberg, Neurologische Klinik
Einfluss einer anormalen X-Chromosomen Inaktivierung (XCI) auf die weibliche Prädisposition für Multiple Sklerose
(Doktormutter: Brigitte Wildemann)
Sommersemester
Lars Brand
Justus-Liebig-Universität Gießen, Medizinisches Zentrum für Neurologie und Neurochirurgie
Effekte der pharmakologischen Inhibition der FGF-Rezeptoren auf Neurodegeneration und Neurogenese des Hippocampus im EAE-Modell
(Doktorvater: Martin Berghoff)
Louis Robert Krause
Universitätsmedizin Göttingen, Institut für Neuroimmunologie und Multiple-Sklerose-Forschung
Einfluss des kostimulatorischen Moleküls CD28 auf die Ausbildung des migratorischen Phänotyps von enzephalitogenen T-Zellen
(Doktorvater: Fred Lühder)
Hannah Solchenberger
Technische Universität Dresden, Zentrum für klinische Neurowissenschaften - Neuroimmunologisches Labor, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus
Projekt-Titel: SARS-CoV-2 spezifische T Zell versus B Zell Immunität nach Vakzinierung bei Multiple Sklerose Patienten mit Sphingosin-1-Rezeptormodulation
(Doktormutter: Katja Akgün)
Nils Treiber
Ludwig-Maximilians-Universität München, Institut für Klinische Neuroimmunologie, Biomedizinisches Zentrum
Verhalten und Remyelinisierungsfähigkeit von Oligodendrozyten in einem kortikalen Modell der Multiplen Sklerose
(Doktorvater: Martin Kerschensteiner)
Paulina Trendelenburg
Ruhr Universität Bochum, Universitätsklinikum der Ruhr-Universität St. Josef-Hospital, Zentrum für Neuroimmunologie Zentrum für klinische Forschung I
Longitudinale Analyse von Eomesodermin+ T Zellen als Marker für Progression bei Multiple Sklerose
(Doktorvater: Simon Faissner)
Wintersemester
Larissa Gümpelein
Philipps-Universität Marburg, Fachbereich 20. Medizin, Augenheilkunde/ Experimentelle Ophthalmologie
Der Einfluss des Anaphylatoxins C3a aus NMOSD- und MS-Seren auf die Endothelzellen der Blut-Hirn-Schranke
(Doktormutter: Diana Pauly)
Katerina Manzhula
Universitätsmedizin Rostock, Institut für Anatonmie
Untersuchung der choroidal-parenchymalen Migration lymphatischer Zellen im Multiple Sklerose – Tiermodell
(Doktorvater: Markus Kipp)
Luisa Mutschler
Ludwig-Maximilians-Universität München, Institut für klinische Neuroimmonologie
Einzelzell-ATAC-Sequenzierung von autoreaktiven T-Zellen im Blut und Liquor von Patienten mit Multipler Sklerose
(Doktormutter: Lisa Ann Gerdes)
Darja Schunin
Justus-Liebig-Universität Gießen, Medizinisches Zentrum für Neurologie und Neurochirurgie
Effekte des FGFR-Inhibitors Infigratinib auf zerebelläre Inflammations- und Degenerationsprozesse in der MOG35-55-induzierten experimentellen autoimmunen Enzephalomyelitis
(Doktorvater: Martin Berghoff)
Sonja Stephan
Universitätsmedizin Mainz, Klinik und Poliklinik für Neurologie Rhein–Main-Neuronetz
Kalziumaktivitäts-Markierung mittels CaMPARI2 zur molekularen Charakterisierung entzündlich-vermittelter neuronaler Schadensprozesse
(Doktorvater: Stefan Bittner)
Sommersemester
Klara Eglseer
Ludwig-Maximilians-Universität München, Institut für klinische Neuroimmonologie
Transkriptom-Analyse der CD8+ T-RM (Tissue-resident memory) T-Zellen in Blut und Liquor bei monozygoten Zwillingen mit Diskordanz für Multiple Sklerose
(Doktormutter: Lisa Ann Gerdes)
Ricardo Lopes Fonseca
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Institut für Neuroimmunologie und Multiple Sklerose (INIMS), Zentrum für Molekulare Neurobiologie Hamburg (ZMNH)
P2Y1-vermittelte Neuroprotektion in der Multiplen Sklerose
(Doktorvater: Manuel A. Friese)
Niel Mehraein
Institut für klinische Neuroimmunologie, LMU Klinikum, Biomedizinisches Zentrum
Molekulare Regulation der Phagozytenpolarisierung in entzündlichen ZNS Läsionen
(Doktorvater: Martin Kerschensteiner)
Lea Sophie Merkel
Institut für klinische Neuroimmunologie, LMU Klinikum, Biomedizinisches Zentrum
Die Rolle des GABA-B2-Rezeptors in der Regulation der Makrophagenfunktion im Mausmodell der Multiplen Sklerose
(Doktorvater: Martin Kerschensteiner)
Philip Lennart Poser
Department für Neurologie (Klinik für Neurologie, Ruhr Universität Bochum - St. Josef Hospital
Untersuchung der Wirkung einer Kombinationstherapie aus Dimethylfumarat und Propionat im Vergleich zu einer Monotherapie mit Dimethylfumarat bei Patienten mit schubförmig remittierender Multipler Sklerose anhand der sNfL- und EDSS-Werte mithilfe einer retrospektiven matched-pair Kohortenstudie
(Doktorvater: Ralf Gold)
Thomas Thäwel
Neurologische Klinik, Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg, Universitätsklinikum Mannheim, Mannheimer Zentrum für Translationale Neurowissenschaften, Interdisziplinäres Zentrum für Neurowissenschaften der Universität Heidelberg
Molekulare zelltypspezifische Segmentierung des Neokortex bei der Multiplen Sklerose
(Doktorvater: Lucas Schirmer)
Wintersemester
Moataz Alabdullah
„Experimentelle Neuroimmunologie“ Institut für Medizinische Immunologie, Charité - Universitätsmedizin Berlin
Untersuchung der Aktivierung des Inflammasomkomplexes NLRP3 in Astrozyten und Monozyten durch CIS, MS und NMO Sera
(Doktormutter: Carmen Infante-Duarte)
Ana Margarida Cavaco Antunes
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Institut für synaptische Psychologie
Untersuchungen zum Einfluss von TRPM4 auf inflammatorische Prozesse im
Mausmodell der Multiplen Sklerose
(Doktormutter: Laura Laprell)
Julia Gärtner
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Institut für Neuroimmunologie und Multiple Sklerose (INIMS), Zentrum für Molekulare Neurobiologie Hamburg (ZMNH)
Entzündliche Proteintransmission in der Pathogenese der MS Neurodegeneration
(Doktorvater: Manuel A. Friese)
Christina Noll
Technische Universität München, Neurologische Klinik und Poliklinik
Einfluss des intrathekalen Immunphänotyps auf retinale Gefäßveränderungen im Rahmen der Multiplen Sklerose
(Doktorvater: Benjamin Knier/)
Raphael Raspe
Immundynamik und Intravitalmikroskopie, Charité - Universitätsmedizin und DRFZ Berlin
Strukturelle und funktionelle Veränderungen der Retina als Diagnose- und
Verlaufsparameter chronischer Neuroinflammation
(Doktormutter: Anja E. Hauser)
Johannes Simon Stalter
Universitätsklinik für Neurologie am Evangelischen Krankenhaus Oldenburg, Carl von Ossietzky Universität
Accelerated long term forgetting bei MS-Patienten: Anwendung einer neuropsychologischen Testmethode zur Detektion alltagsrelevanter Gedächtnisdefizite im frühen Stadium der Multiplen Sklerose
(Doktorvater: Karsten Witt)
Sommersemester
Gregor W. Böttiger
Neurologische Klinik, Justus-Liebig-Universität Gießen
Effekte des FGFR-Inhibitors BGJ398 auf die periphere T-Zell-Antwort in Mäusen mit MOG-induzierter EAE
(Doktorvater: Martin Berghoff)
Nora Friedrich
Klinik für Neurologie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Kiel
Untersuchung zu Lymphopenie bei Behandlung mit Fumarsäureestern
(Doktormutter: Klarissa Stürner)
Nafiye Genc
Institut für Neuropathologie, Universitätsmedizin Göttingen
Von Markschattenherden lernen – Wege zur effizienten Remyelinisierung bei multipler Sklerose
(Doktormutter: Christine Stadelmann-Nessler)
Hannah Kapell
Neurologische Klinik, Universitätsmedizin Mannheim
Untersuchung der selektiven neuronalen Vulnerabilität bei entzündlicher Demyelinisierung
(Doktorvater: Lucas Schirmer)
Vladyslav Kavaka
Institut für Klinische Neuroimmunologie, Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München
Transkriptom-Analyse der CD8+ T-RM T-Zellen im peripheren Blut bei monozygoten Zwillingen mit Diskordanz für Multiple Sklerose mittels Einzelzell-RNA-Sequenzierung
(Doktormutter: Lisa Ann Gerdes)
Wintersemester
Clara Batzdorf
Institut für Medizinische Immunologie, Charité - Universitätsmedizin Berlin
Untersuchung geschlechtsspezifischer Veränderungen der extrazellulären Matrix und der mechanischen Eigenschaften des Gehirns während der EAE
(Doktormutter: Carmen Infante-Duarte)
Nadine Heiden
Klinik für Anästhesiologie, Universitätsklinikum Münster
Untersuchungen zur Bedeutung von missgefalteten Proteinen und ihres Rezeptors
CD36 für die Pathogenese der Multiplen Sklerose
(Doktormutter: Beate Kehrel)
Michael Kutza
Neurologische Klinik, Universitätsmedizin Mannheim
B-Zell Neurodegeneration und Subtypisierung bei der Multiplen Sklerose
(Doktorvater: Lucas Schirmer)
Helena Lichtenfeld
Institut für Neuroimmunologie und Multiple Sklerose (INIMS), Zentrum für Molekulare Neurobiologie (ZMNH), Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Bewegungsinduzierte neuroprotektive Mechanismen in der Multiplen Sklerose
(Doktorvater: Manuel Friese)
Luise Reukauf
Experimental and Clinical Research Center (ECRC), Charité - Universitätsmedizin Berlin
Charakterisierung von ZNS-ständigen CD4+ THelferzellen und deren Umgebungszellen in der chronischen Neuroinflammation
(Doktorvater: Volker Siffrin)
Felix Wullenkord
Neurologische Klinik der Ruhr-Universität Bochum, St. Josef-Hospital Bochum
Rauchen als kritischer Umweltfaktor in der Multiplen Sklerose: Die Rolle des
Aryl-Hydrocarbon-Rezeptors als möglicher Vermittler
(Doktorvater: Aiden Haghikia)
Sommersemester
Willy Nelson Pameni Tiemeni
Institut für Neuropathologie, Universitätsmedizin Göttingen
Einfluss des Verlusts von Mikrogliazellen auf die Remyelinisierung im experimentellen Modell und bei der multiplen Sklerose
(Doktormutter: Christine Stadelmann-Nessler)
Roxanne Pretzsch
Klinik für Neurologie und Institut für Neuropathologie, Universitätsmedizin Göttingen
Untersuchung regulatorischer B-Zellfunktion im Tiermodell der Multiplen Sklerose – Implikationen für zukünftige Therapiestrategie
(Doktorvater: Martin S. Weber)
Wintersemester
Lina Anderhalten
Institut für Medizinische Immunologie, Charité - Universitätsmedizin Berlin
Untersuchung der Effekte der Gadolinium-Ablagerung im ZNS im Rahmen der Neuroinflammation am Maus- und in vitro Modell
(Doktormutter: Carmen Infante-Duarte)
Lukas Can Bal
Institut für Neuroimmunologie und Multiple Sklerose (INIMS), Zentrum für Molekulare Neurobiologie (ZMNH), Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Die Rolle der neuronalen microRNA-155 in der entzündungsinduzierten Neurodegeneration (Doktorvater: Manuel Friese)
Robert Büse
Institut für Neuropathologie, Universitätsmedizin Göttingen
Mikroglia-Aktivierung und Modifikation des homöostatischen Phänotyps bei multipler Sklerose und AQP4-seropositiver Neuromyelitis optica
(Doktormutter: Christine Stadelmann-Nessler)
Nicholas Hanuschek
Klinik und Poliklinik für Neurologie, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz
Spezifische Effekte des Zytokins Interleukin-4 und synthetischer Interleukin-4 Rezeptor Agonisten auf Neurone und Myelin in der Multiplen Sklerose
(Doktormutter: Christina Vogelaar)
Sommersemester
Rosa Brand
Klinikum und Poliklinik für Neurologie, Klinikum rechts der Isar der TU München
Antigen-getriebene Affinitätsreifung von B-Lymphozyten in meningealem ektopischen Lymphgeweben in einem Modell der Multiplen Sklerose
(Doktorvater: Klaus Lehmann-Horn)
Katharina Heß
Institut für Neuropathologie, Wilhelms-Universität Münster
Entzündung in MS-Läsionen – Freund oder Feind der Remyelinisierung?
(Doktormutter: Tanja Kuhlmann)
Lea Müller
Medizinische Fakultät – Anatomie und Zellbiologie, Universität des Saarlandes, Homburg
Der Wirkmechanismus von Probenecid bei der Therapie der Experimentellen Autoimmunen Enzephalomyelitis
(Doktormutter: Carola Meier)
Cora Nau-Gietz
Institut für Neuropathologie, Universitätsmedizin Göttingen
Analyse BCAS1-positiver Oligodendrozyten als Marker für aktive Remyelinisierung bei multipler Sklerose
(Doktormutter: Christine Stadelmann-Nessler)
Puya Shalchi-Amirkhiz
Zentrum für klinische Neurowissenschaften- Multiple Sklerose Zentrum, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Technische Universität Dresden
Beurteilung zellmechanischer Eigenschaften unterschiedlicher peripherer immunologischer Zellpopulationen mittels real-time fluorescence und deformability cytometry (RT-FDC) bei Multiple Sklerose Patienten und Evaluation der Modellierbarkeit unter spezifischen Therapiestrategien
(Doktorvater: Tjalf Ziemssen)
Carolin Dreyer
Institut für Neuropathologie, Universitätsmedizin Göttingen
Entmarkungsaktivität, Entzündungszellinfiltration und Komplementablagerung in frühen Multiple Sklerose‐ und Neuromyelitis optica‐Läsionen
(Doktormutter: Christine Stadelmann-Nessler)
Marco Gallus
Department für Neurologie, Universitätsklinikum Münster
Charakterisierung der löslichen Adenylylzyklase als möglichen Ansatz zur MS-Therapie (Doktorvater: Sven Meuth)
Julia Loos
Klinik für Neurologie, Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz
Understanding neurodegeneration: Identification of novel pathways underlying inflammatory-driven neuronal injury
(Doktorvater: Stefan Bittner)
Marcel Seungsu Woo
Institut für Neuroimmunologie und Multiple Sklerose (INIMS), Zentrum für Molekulare Neurobiologie (ZMNH), Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Identifikation von neuronalen Adaptationswegen bei mitochondrialer Dysfunktion zur therapeutischen Induktion neuronaler Resilienz bei der Multiplen Sklerose
(Doktorvater: Manuel Friese)
Cornelia Würthwein
Abteilung für Neurologie - Molekulare Neuroimmunologie, Universität Heidelberg
Defective cross-talk between B cells and regulatory T cells: connecting the dots in the emergence of impaired peripheral B-cell tolerance in multiple sclerosis?
(Doktormutter: Brigitte Wildemann)
Daniel Brunotte-Strecker
Charité - Universitätsmedizin Berlin
Charakterisierung der innate lymphoid cells (ILC) im ZNS und peripheren Immunorganen in der schubförmigen EAE und MS
(Doktormutter: Carmen Infante-Duarte)
Florian Graz
Klinik für Neurologie, St. Josef-Hospital, Klinikum der Ruhr-Universität Bochum
Mechanismen immunologischer und degenerativer Schädigung an Sehnerv und Retina bei Antikörper-vermittelter Demyelinisierung
(Doktorvater: Ingo Kleiter)
Christina Mayer
Neurologische Klinik, Universitätsklinikum Heidelberg
Degenerative synaptische Veränderungen retinaler Ganglienzellen der Ratte in Folge von experimenteller autoimmuner Optikusneuritis
(Doktormutter: Ricarda Diem)
Laura Petrikowski
Klinik für Neurologie, St. Josef-Hospital, Klinikum der Ruhr-Universität Bochum
Mechanismen immunologischer und degenerativer Schädigung an Sehnerv und Retina bei Antikörper-vermittelter Demyelinisierung
(Doktorvater: Ingo Kleiter)
Falk Steffen
Klinik für Neurologie, Universitätsmedizin Mainz
Die Rolle der Kaliumkanäle KCNK5/6 für die Funktion Dendritischer Zellen und Makrophagen in der Multiplen Sklerose
(Doktorvater: Stefan Bittner)
Informationen zur nächsten Ausschreibung
Bewerbungen für das Sommersemester (Förderbeginn 01.04.) sind jeweils vom 15. Oktober bis zum 15. Dezember eines Jahres möglich.
Bewerbungen für das Wintersemester (Förderbeginn 01.10.) sind jeweils vom 15. April bis zum 15. Juni eines Jahres möglich.
Ausschreibung als PDF
Senden Sie uns gerne eine Mail über folgenden Button, wenn wir Sie in Zukunft über aktuelle wissenschaftliche Ausschreibungen informieren sollen.
E-Mail senden
medMS-MyLab-Programm für Ärztinnen und Ärzte
Mit dem medMS-MyLab Programm haben herausragende Ärztinnen und Ärzte in der Facharztausbildung Gelder beantragt, um ihre Forschung nachhaltig und langfristig weiterzuverfolgen. Dabei ging es ausdrücklich nicht um eine Projektförderung, sondern um die Perspektive und Entwicklung der geförderten Person im Sinne eines Clinician Scientist mit eigenständiger und hochrangiger Forschung.
Es konnten in einem zeitlich flexiblen Rahmen Mittel für den Aufbau, die qualitative Weiterentwicklung oder Verstetigung des eigenen Arbeitsfelds beantragt werden. Pro Person konnten bis zu 400.000 € beantragt werden; es wurden jährlich zwei Forschende gefördert.
Unterstützte Ärztinnen und Ärzte
Angegeben sind jeweils das Jahr der Projektbewilligung und die antragstellende Person.
PD Dr. Lucas Schirmer (Universitätsmedizin Mannheim, Universität Heidelberg)
Herr PD Dr. Schirmer beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Grundlagen und Mechanismen der Nervenzellschädigung und chronischen Entzündung bei der Multiplen Sklerose. Das Interesse seiner Arbeitsgruppe liegt in einem besseren Verständnis des Fortschreitens der Erkrankung unter Zuhilfenahme eines breiten Methodenspektrums aus systembiologischen Ansätzen, experimentellen Modellen und Humanpathologie.
Dr. Lisa Ann Gerdes (Institut für Klinische Neuroimmunologie am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München)
Frau Dr. Gerdes hat seit 2012 eine weltweit einzigartige Kohorte mit mehr als 60 eineiigen Zwillingspaaren aufgebaut mit der Besonderheit, dass jeweils ein Zwilling an Multipler Sklerose (MS) erkrankt ist, während der andere keine erkennbaren Anzeichen der Erkrankung aufweist. Mit innovativen Forschungsansätzen möchte Frau Dr. Gerdes mögliche Triggerfaktoren, u.a. die Darmflora, sowie verschiedene Biomarker untersuchen, mit dem Ziel die Ursachen der Multiplen Sklerose besser zu verstehen.
Prof. Dr. Stefan Bittner (Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz)
Herr Prof. Bittner konzentriert sich in seiner Forschung auf chronisch-entzündliche Prozesse bei der Multiplen Sklerose. Aufbauend auf sehr beachteten Vorarbeiten möchte er in den kommenden Jahren mit seinem Forschungsteam umfangreiche Studien rund um den schädigenden Einfluss von Kalziumionen auf Nervenzellen durchführen, die zu einem tieferen Verständnis dieses Signalwegs führen und neue therapeutische Konzepte ermöglichen.
PD Dr. Klaus Lehmann-Horn (Klinikum rechts der Isar der TU München)
Herr Dr. Lehmann-Horn möchte im Rahmen des vorliegenden Projekts den chronischen Krankheitsverlauf der Multiplen Sklerose studieren und sich auf Entzündungsszellen konzentrieren, von denen man vermutet, dass sie – wenn sie in hoher Zahl vorliegen – eine Rolle bei der Entstehung und auch dem Fortschreiten der Erkrankung spielen.
Dr. Volker Siffrin (Charité Berlin)
Herr Dr. Siffrin möchte Studien zur Neurodegeneration, also dem Untergang von Nervengewebe, bei der MS durchführen und im Rahmen dieser sog. Biomarker identifizieren, die für die MS so dringend benötigt werden, um prognostische Aussagen zum Krankheitsverlauf und der Behinderungsentwicklung treffen zu können.
Prof. Dr. Ricarda Diem (Universität Heidelberg)
Frau Prof. Diem arbeitet seit vielen Jahren intensiv auf dem Gebiet der Sehnerventzündung, die häufig im Rahmen einer MS auftritt und Aufschluss über die Krankheitsentstehung liefert. In den kommenden Jahren möchte sie mit ihrem Forschungsteam umfangreiche Studien durchführen, um die Mechanismen dieser Erkrankung zu entschlüsseln.
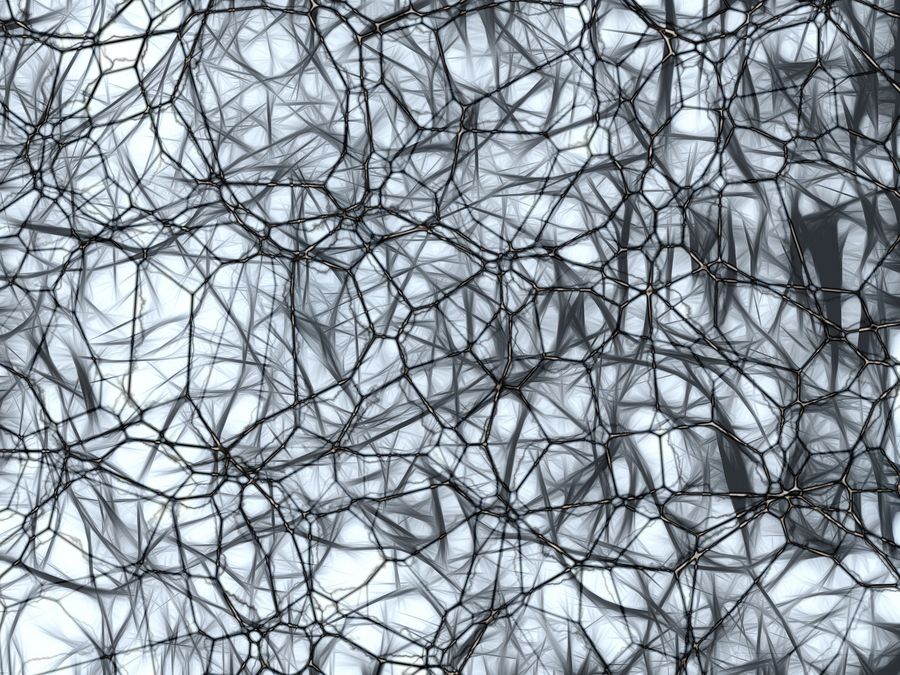

Hertie MS Symposium
Beim jährlichen Hertie MS Symposium auf Schloss Liebenberg treffen sich rund 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, um zwei Tage lang aktuelle Aspekte der Multiple-Sklerose-Forschung zu diskutieren.
Das Treffen bringt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die seit Jahren erfolgreich in der Forschung aktiv sind, mit jenen zusammen, die am Anfang ihrer wissenschaftlichen Laufbahn stehen. Bewusst gibt es neben den Sessions viel Raum für Austausch und Networking.
Die wissenschaftliche Ausgestaltung der Veranstaltung erfolgt durch ein Scientific Committee, bestehend aus Burkhard Becher (Zürich), Stefan Bittner (Mainz), Martin Kerschensteiner (München), Luisa Klotz (Münster), Frederike Cosima Oertel (Berlin), Anne-Katrin Pröbstel (Basel) und Heinz Wiendl (Münster).
Kontakt
Dr. Eva Koch
Melanie Bommersheim
Interviews & Reportagen zum Thema
Weiterlesen.
Hertie-Preis und Förderungen bei MS und Erkrankungen des Nervensystems. Wir vergeben den Hertie-Preis und verschiedene Förderungen an Individuen, Verbände und Initiativen im Bereich der Multiplen Sklerose und anderen Erkrankungen des Nervensystems.
Hertie Network & Academy. Das Hertie Network of Excellence in Clinical Neuroscience und die Hertie Academy of Clinical Neuroscience fördern und vernetzen exzellente Neurowissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler. Das Programm ist ein einzigartiges Forschungsnetzwerk und Nachwuchsförderprogramm für die klinischen Neurowissenschaften.



