
Interview mit Prof. Dr. Ludger Schöls
Ich hoffe, dass es in den nächsten zehn Jahren einen großen Boom an solchen neuen Therapien gibt.
Der Tag der seltenen Erkrankungen findet immer am letzten Tag im Februar statt. In diesem Jahr wird daher am 28.02. auf die Probleme, Nöte und Anliegen von Menschen aufmerksam gemacht, die an einer seltenen Erkrankung leiden. Betroffene haben mit vielen Einschränkungen und Belastungen zu kämpfen: Es gibt kaum Therapien oder Medikamente und der Weg zur Diagnose ist für viele eine Odyssee. Prof. Dr. Ludger Schöls, Forscher am Hertie-Institut für klinische Hirnforschung in Tübingen, leitet das Zentrum für Seltene Neurologische Erkrankungen und Entwicklungsstörungen. „Ich hoffe, dass es in den nächsten zehn Jahren einen großen Boom an neuen Therapien für Patienten mit seltenen Erkrankungen gibt.“
Eine Erkrankung gilt als selten, wenn höchstens einer von 2000 Menschen davon betroffen ist. Obwohl das wenig klingt, leiden in Deutschland rund drei Millionen Menschen an einer seltenen Erkrankung, die meist chronisch und oft lebensverkürzend ist. „Die meisten seltenen Erkrankungen können bis jetzt nicht behandelt werden“, sagt Prof. Dr. Ludger Schöls (56), Leiter der Klinischen Neurogenetik am Hertie-Institut für klinische Hirnforschung (HIH), einem der bundesweit größten und modernsten Zentren zur Erforschung neurologischer Erkrankungen. „Doch wir finden mithilfe der Genetik mittlerweile sehr oft genau die Stelle, an der die Krankheit entsteht. Als nächstes wollen wir die Mechanismen aufdecken, die zu dieser Krankheit führen, um dann sehr individuelle Therapien für die Betroffenen zu entwickeln.“ Die Gemeinnützige Hertie-Stiftung, die das HIH seit Gründung mit rund 30 Millionen Euro unterstützt hat, sprach mit dem Forscher.
»Ich hoffe, dass es in den nächsten zehn Jahren wirklich einen grossen Boom an solchen neuen Therapien gibt.«
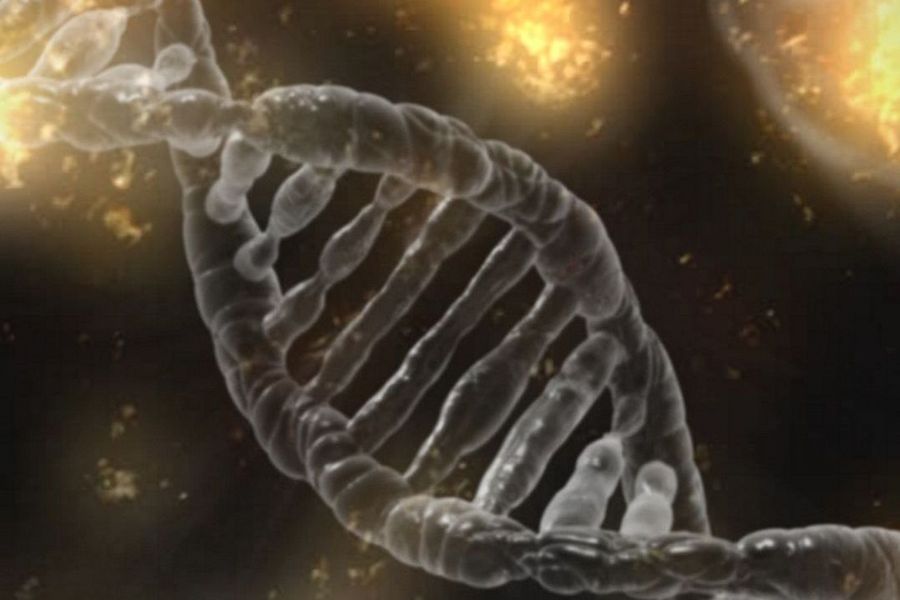
Herr Professor Schöls, zurzeit kennt man weltweit rund 8000 seltene Erkrankungen. Ist das nur die Spitze des Eisbergs oder sind damit fast alle seltenen Erkrankungen entdeckt?
In unsere Ambulanz für Seltene Neurologische Erkrankungen und Entwicklungsstörungen kommen pro Jahr rund 1500 Patienten. Bei der einen Hälfte finden wir die Ursache und haben damit eine genaue Diagnose. Alle anderen Fälle sind noch offen. Wir können die Symptome einer Erkrankungsgruppe zuordnen, wissen aber nicht, woher sie letztendlich kommen. Daher vermute ich, dass sich die Zahl der seltenen Erkrankungen zumindest in meinem Fachgebiet noch verdoppeln wird.
Können Sie den Patienten weiterhelfen?
Lange Zeit mussten wir uns anhören, dass wir das nie schaffen würden. Die Entwicklungen der vergangenen Jahre aber lassen hoffen, dass in absehbarer Zeit auch für seltene Erkrankungen neue Therapiemöglichkeiten entwickelt werden. Ein gutes Beispiel ist die vor Kurzem von uns veröffentlichte Studie mit Patienten, die an einer besonderen Form der Hereditären Spastischen Spinalparalyse leiden, der SPG5. Wir haben Biomarker identifiziert und entdeckt, dass die Höhe bestimmter Blutfette mit dem Schweregrad der Krankheit in Zusammenhang steht. Wir hoffen nun, dass blutfettsenkende Mittel die Erkrankung lindern. Das wird eine sehr individuelle Therapie nur für die wenigen Menschen mit einer SPG5 werden. Aber der Grundgedanke, die entscheidenden Mechanismen aufzudecken, die zu einer Krankheit führen, um diese dann positiv zu beeinflussen, wird hoffentlich später auch für andere Erkrankungen einsetzbar sein. Ich hoffe, dass es in den nächsten zehn Jahren wirklich einen großen Boom an solchen neuen Therapien gibt.
Wie erkennt man eine seltene Erkrankung bei einem Patienten?
Wenn andere, gängige Erkrankungen ausgeschlossen wurden und die Herkunft der Beschwerden unerklärt bleibt, dann schauen wir, ob das Krankheitsbild zu einer der seltenen Erkrankungen passt. Wir gehen mit den Patienten die Krankengeschichten in ihren Familien durch und sehen uns die Beschwerden der Eltern, Großeltern und Geschwister an. Wenn man dann auf ähnliche Symptome stößt und die Beschwerden zudem früh im Leben auftreten, ist es wahrscheinlich, dass es sich um eine genetisch bedingte, seltene Erkrankung handelt.
Gehen Sie regelrecht auf Spurensuche, wenn Sie einen Patienten vor sich haben, bei dem keiner genau weiß, woran er erkrankt ist?
Ja, das ist bei jedem einzelnen Patienten die Aufgabe. Zunächst machen wir breite genetische Tests, die vergleichsweise wenig aufwendig und schnell zu machen sind. Die Ataxie oder die Spastische Spinalparalyse sind keine einzelnen Erkrankungen, sondern Erkrankungsgruppen, die durch hundert oder mehr Gene verursacht werden können. In der Regel bekommen wir eine Liste von Genen, auf der drei bis zehn Varianten stehen, die die Ursache sein können. Hier nehmen wir die Spurensuche wieder auf und gucken, welche der Genveränderungen in der jeweiligen Familie die wirkliche Ursache für die Erkrankung ist.

Was reizt Sie an Ihrer Arbeit am meisten?
Mich fasziniert, dass wir häufig die Ursache einer Erkrankung finden. Das gibt es in der Medizin extrem selten. Jemand, dem Insulin fehlt, hat Diabetes, aber das ist nicht die wirkliche Ursache. Die Frage ist ja, warum der Patient kein Insulin hat, warum seine insulinproduzierenden Zellen zugrunde gegangen sind. Da es aber für Diabetes eine Behandlungsmöglichkeit gibt, geben sich Ärzte und Patienten damit meistens zufrieden. Die allermeisten seltenen Erkrankungen sind bis heute nicht behandelbar. Daher versuchen wir, die Ursachen zu ermitteln und ganz frühe Schritte in der Krankheitsentstehung zu entdecken, an denen wir möglicherweise therapeutisch eingreifen können. Das Aufdecken der genetischen Ursachen ist so faszinierend, weil wir damit die seltene Möglichkeit haben, diese Erkrankung von ihrer Ursache her zu erforschen. Wir sind daher an einem echten Heilen viel näher dran als anderswo in der Medizin.
Ist das auch der Grund, warum Sie diese Richtung eingeschlagen haben? Sie haben zu dem Thema habilitiert.
Mein alter Chef sagte: „Kümmere Dich mal um die Ataxien, da muss es ganz viel zu entdecken geben.“ Damals war ich noch nicht so begeistert, weil kein Land in Sicht war. Aber zu der Zeit kam die Genetik auf, die ein Schlüssel für diese Erkrankungen ist. So konnten wir mit der breiten Sequenzierung genetischer Codes Krankheiten erklären, was mich sehr fasziniert hat.
Wie häufig entdecken Sie eine vollkommen neue seltene Erkrankung und wie viele haben Sie im Laufe der Zeit schon gefunden?
Eine Erkrankung, die zu einer Mutation in einem neuen Gen gehört, finden wir vielleicht ein- oder zweimal im Jahr. Bisher hat meine Arbeitsgruppe etwa fünfzehn neue seltene Erkrankungen entdeckt.
Wie muss man sich die Forschung an seltenen Erkrankungen und die Arbeit mit Patienten vorstellen?
Wir haben in der Neurologie das Problem, dass wir das erkrankte Organ – Gehirn oder Rückenmark – nicht unter das Mikroskop legen und seine biochemischen Funktionen untersuchen können. Seit ein paar Jahren können wir aber Hautzellen in Stammzellen umwandeln, die genetisch völlig identisch sind mit unserem Patienten. Diese Stammzellen differenzieren wir dann wieder zu Nervenzellen aus und untersuchen im Labor genau die Zellen, die bei diesem Menschen krank werden. An den Nervenzellkulturen studieren wir, wie sich die Erkrankung in ihren allerersten Schritten entwickelt und was in welcher Reihenfolge passiert: Wird zum Beispiel ein Enzym nicht richtig gebildet, können wir die biochemischen Veränderungen messen, die das mit sich bringt, und danach die Auswirkungen, die dies auf das Wachstum und die Funktion der Nervenzellen hat.
Mehr Informationen
Das Spezialzentrum für Seltene Neurologische Erkrankungen und Entwicklungsstörungen in Tübingen behandelt Patienten mit familiär gehäuft vorkommenden neurologischen Erkrankungen.
Hier erfahren Sie mehr über das Hertie-Institut für klinische Hirnforschung
Wie geht es dann weiter?
Mit diesen Ergebnissen kann man Ideen entwickeln, wo man am ehesten in den Krankheitsmechanismus eingreifen kann. Das probieren wir dann auch mit diesen Zellen aus und schauen, ob wir sie heilen können. Das ist ein mehrstufiger Prozess. Wenn alles klappt, versuchen wir den Ansatz auf unsere Patienten zu übertragen und eine Therapiestudie für die spezifische Erkrankung durchzuführen. Das macht das Hertie-Institut für klinische Hirnforschung aus: Als einer der führenden Standorte in Europa stellen wir die genetische Diagnose bei unseren Patienten, gehen mit ihren wertvollen Biomaterialien ins Labor und machen dort die Grundlagenarbeit, kommen mit neuen Therapieideen zurück in die Klinik und versuchen, sie in Studien an den Patienten umzusetzen.
Sie sind ärztlicher Leiter des Europäischen Referenzzentrums für Seltene Neurologische Erkrankungen, aktiv im Förderverein des Zentrums für Seltene Erkrankungen und in verschiedenen Selbsthilfegruppen tätig. Wie schaffen Sie das alles neben Ihrer täglichen Arbeit in der Klinik?
Das ist ganz einfach: Meine Arbeit begeistert mich, das ist ein Motor, der viel positive Energie freisetzt.
Haben Sie neben der Arbeit noch Zeit für andere Dinge?
Ich habe vor allem eine Familie, die mich im normalen Leben hält: Meine Frau, unsere vier Kinder und zwei Enkelkinder sind wirklich das Wichtigste für mich.
Wie bekommen Sie den Kopf frei?
Am liebsten fahre ich in die Berge. Das müssen gar keine spektakulären Gipfel sein. Das Laufen in dieser Landschaft und das reduzierte Leben auf den Hütten ist das, was mir wirklich am meisten gefällt. Nirgendwo wird der Kopf so schnell frei wie in den Bergen.

