
Interview mit Prof. Ghazaleh Tabatabai, Juni 2022
Nur weil etwas möglich ist, muss es nicht zum Wohle der Patienten sein
Am 8. Juni ist Welthirntumortag
Jedes Jahr erkranken hierzulande mehr als 8.000 Menschen an einem bösartigen Hirntumor; die Zahl der Patientinnen und Patienten mit Hirnmetastasen infolge anderer Krebsleiden ist mit mehr als 22.000 im Jahr sogar noch höher. Prof. Dr. Dr. Ghazaleh Tabatabai ist Ärztliche Direktorin der Abteilung Neurologie mit interdisziplinärem Schwerpunkt Neuroonkologie am Hertie-Institut für klinische Hirnforschung (HIH) in Tübingen. In unserem Interview zum Welthirntumortag am 8. Juni erläutert die Expertin, auf welche Therapieansätze sie im Kampf gegen Hirntumoren setzt, wie sie mit einer neuen Immuntherapie-Studie gegen Metastasierung in Hirnhäuten vorgehen will, und warum medizinischer Fortschritt manchmal eben nicht sofort in der Behandlung anwendbar sein kann.
Welche Nachricht hat Sie als Neuroonkologin und Expertin für Hirntumoren seit dem Welthirntumortag im vergangenen Jahr besonders bewegt?
Im Kontext der Corona-Pandemie haben die mRNA-Vakzine, wie sie von Biontech entwickelt wurde, einen beeindruckenden Durchbruch erlebt. Als Neuroonkologin lässt mich diese Entwicklung nicht unberührt, denn mit den mRNA-Vakzinen ergeben sich auch für die Krebstherapie vielfältige Möglichkeiten. Ein Beispiel wäre der Bereich der therapeutischen Impfungen, die zum Ziel haben, das Immunsystem eines Krebspatienten optimal für den Kampf gegen den Tumor zu mobilisieren und anzuleiten. Dabei kann die mRNA-Technologie eine besondere Rolle spielen. Wir erarbeiten derzeit Konzepte dazu.
Sie haben eine neue Immuntherapie-Studie zur Behandlung von Meningeosis neoplastica gestartet, was verbirgt sich hinter dem Fachbegriff?
Aktuellen Schätzungen zufolge werden etwa ein Viertel aller Tumorpatienten im Laufe ihrer Erkrankung eine Metastasierung in das zentralen Nervensystems (ZNS) erleiden, und die Meningeosis neoplastica ist eine Sonderform der ZNS-Metastasierung. Die Tumorzellen siedeln sich hierbei im Nervenwasser oder im Bereich der Hirnhäute ab. Es handelt sich meist um ein Stadium einer Tumorerkrankung, das recht fortgeschritten ist und eine therapeutische Herausforderung darstellt.
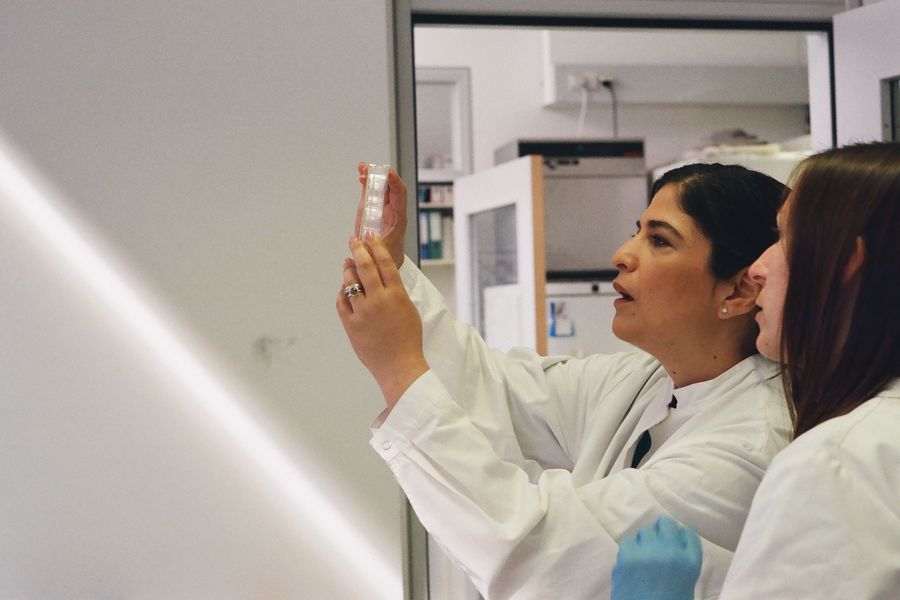
"Wir geben den PD1-Antikörper Nivolumab nicht in die Vene, sondern verabreichen ihn in das Hirnwasser und somit direkt an den Ort des Geschehens. Auf diese Weise wird die Blut-Hirn-Schranke umgangen, die viele Medikamente auf ihrem Weg aus dem Blut in das zentrale Nervensystem behindert."
Wie sieht der Ansatz Ihrer Studie aus?
In unserer nun anlaufenden Phase-1-Studie setzen wir den PD1-Antikörper Nivolumab ein, allerdings mit einer anderen Verabreichungsform. PD1-Antikörper sind bereits für die Behandlung verschiedener solider Tumoren, also bösartiger Geschwülste, die sich überall im Körper entwickeln können, zugelassen. Sie werden üblicherweise über die Vene verabreicht. Wir geben den PD1-Antikörper Nivolumab nicht in die Vene, sondern verabreichen ihn in das Hirnwasser und somit direkt an den Ort des Geschehens. Auf diese Weise wird die Blut-Hirn-Schranke umgangen, die viele Medikamente auf ihrem Weg aus dem Blut in das zentrale Nervensystem behindert. Man nennt diese Applikationsart intrathekal. Der Vorstand der Neuroonkologischen Arbeitsgemeinschaft (NOA) der Deutschen Krebsgesellschaft führt unsere Studie als „NOA-26“-Studie, sie wird vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg gefördert.
Klingt interessant, aber auch ein bisschen gruselig …
Ja, es mag auf den ersten Blick seltsam klingen, aber die intrathekale Verabreichung oder auch die Punktion des Hirnwasserraums sind ja an sich nichts Neues und werden schon sehr lange praktiziert, nicht nur in der Krebsbehandlung. In der Geburtshilfe gibt es das auch, man geht mit einer feinen Nadel in den Nervenwasserraum, der das Rückenmark umgibt, und spritzt dort ein Anästhetikum hinein. Die gleiche Punktionstechnik haben wir bei einer Routine-Nervenwasserpunktion. Die Zugangswege zur Medikamentengabe in das Hirnwasser lassen sich also durch leichte Eingriffe realisieren. Das geschieht entweder über einen Katheter, der mit einer Hirnwasserkammer in Verbindung steht - ein sogenanntes Reservoir - oder über eine Lumbalpunktion. In unserer Studie erfolgt die Applikation über ein Reservoir.
Durch die Studie soll die Verträglichkeit von Nivolumab bei der intrathekalen Anwendungsweise untersucht werden - was kommt auf die Teilnehmenden zu?
Die Verträglichkeit ist bei einer neuen Applikationsart immer wichtig und übrigens bei allen Phase-1-Studien ein wichtiger Endpunkt, das ist also ein gängiges Vorgehen. Bei Nivolumab handelt es sich um ein Medikament, das bekannt ist und weltweit angewendet wird. Zu bedenken ist auch, dass Nivolumab, auch wenn es über die Vene verabreicht wird, zu neurologischen Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen oder autoimmunen Entzündungen führen kann. Das kann natürlich auch bei der intrathekalen Gabe passieren, aber wir sind auf diese Nebenwirkungen vorbereitet und erläutern alles ausführlich und verständlich, so dass sich die Patientinnen und Patienten über alles informiert sind und sich dann auch keine unnötigen Sorgen machen müssen.
Gibt es bereits Erfahrungen mit Ihrem Therapieansatz?
Dass man den PD1-Antikörper Nivolumab im Rahmen einer klinischen Studie für Meningeosis neoplastica direkt ins Hirnwasser gibt, ist bisher nur am MD Anderson Cancer Center in Texas und nur für das Melanom, also den „schwarzen Hautkrebs“ erfolgt. Wir erweitern in unserer Studie die Anwendung auf Patienten mit weiteren soliden Tumoren. Wir haben basierend auf den ersten Erfahrungen von der Studie am MD Anderson Cancer Center in USA, die erstmals auf dem ASCO 2020 vorgestellt wurden, im Juli 2020 bei einem Melanom-Patienten mit intrathekalem Nivolumab begonnen. Unser Patient hatte zu jenem Zeitpunkt keine Therapieoptionen mehr, seine zu erwartende Überlebenszeit lag bei wenigen Monaten. Jetzt, also knapp zwei Jahre später, geht er weiterhin seinem Alltag nach, ist berufstätig, und wir behandeln ihn weiterhin mit intrathekalem Nivolumab, mittlerweile mit längeren Pausen zwischen den Applikationen. Dieser Therapieansatz kann also eine Option sein, der das Therapiespektrum für Meningeosis neoplastica erweitern könnte, und deswegen haben wir auch direkt die NOA-26-Studie auf den Weg gebracht, um das systematisch zu ergründen.
"Neue Technologien sorgen für eine enorme Weiterentwicklung der Immuntherapie, deshalb sind Phase-1-Studien auch so wichtig, weil dort Schritt für Schritt alle Fragen, die anstehen, systematisch beantwortet werden können."
Der Fortschritt in der Immuntherapie ist rasant - worauf sollten Patienten bei neuen Therapien achten?
Es stimmt, neue Technologien sorgen für eine enorme Weiterentwicklung der Immuntherapie, deshalb sind Phase-1-Studien auch so wichtig, weil dort Schritt für Schritt alle Fragen, die anstehen, systematisch beantwortet werden können. Zudem prüfen die Ethikkommission und regulatorischen Behörden das Konzept einer klinischen Studie sehr sorgfältig. Dies dient zum Schutz der Patienten und zur Qualitätskontrolle der Studien. Für die Patientinnen und Patienten bedeutet das, dass neue Therapieansätze, von denen sie sich Linderung oder sogar Heilung versprechen, möglichst im Rahmen einer klinischen Studie erfolgen sollte. Die ausgewiesenen und zertifizierten Zentren sind hierfür die richtige Adresse für Beratung, Bewertung und Umsetzung der Therapieansätze.
Was treibt Sie als Ärztin und Forschende gerade um, wenn Sie in die Zukunft blicken?
Ein entscheidender Aspekt unserer klinischen Studien und unserer klinischen Arbeit ist die Perspektive der Patienten und Angehörigen, also zum Beispiel die Linderung der Beschwerden und der Erhalt der Lebensqualität. Natürlich interessieren mich die wissenschaftlichen tumorbiologischen und klinischen Erkenntnisse. Eine reine Verlängerung der Lebenszeit ohne gute Lebensqualität reicht aber meines Erachtens nicht, dann haben wir unseren Auftrag nicht vollständig erfüllt. Für mich persönlich ist ein wichtiges Etappenziel, mehr Präzision und mehr Optionen für die Therapie-Auswahl für unsere Patientinnen und Patienten zu gewinnen. Wir müssen noch genauer abschätzen können, welcher Patient von dieser Behandlung wirklich profitieren könnte. Das heißt aber auch: Wer würde nicht profitieren? Dann könnte man Therapien, die potenziell für die Erkrankten keinen Mehrwert darstellen und eventuell nur Nebenwirkungen verursachen, auch sein lassen und direkt nach anderen Optionen schauen.
Ein weiterer wichtiger Punkt mit Blick in die Zukunft ist die integrative Arbeitsweise und unsere Einstellung, dass wir uns stets weiterentwickeln. Wir sind also auf einer Art unendlichen Reise, wir können nie sagen, dass wir endgültig angekommen sind. Unsere Kompassnadel zeigt zwar immer in die gleiche Richtung, aber es tauchen auf dem Weg natürlich Hügel und Steppen auf, die auch komplexer, steiler, undurchsichtiger und vielfältiger werden können. Diesen Herausforderungen müssen wir uns mit einer positiven Grundhaltung stellen. Dabei sind gemeinsame Lagebesprechungen und Reflexion wichtig. Technik und Forschung entwickeln sich rasant weiter, so dass sehr vieles und auch immer mehr möglich ist und sein wird – aber macht etwas auch immer Sinn, nur weil es ganz neu möglich ist? Ich denke, dass wir wissenschaftlichen und technischen Fortschritt gemeinsam reflektieren und mit Fürsorglichkeit eng verknüpfen müssen. Denn nur, weil etwas rein technisch möglich ist, muss es nicht unbedingt zum Wohle der Patienten sein. Hier eine sinnvolle Balance zu finden, wird entscheidend sein, um den erkrankten Menschen ganzheitlich gerecht zu werden und sie richtig zu betreuen.
Werden Sie Teil unserer Gemeinschaft – abonnieren Sie unseren Newsletter!
INFO Das Interview führte Rena Beeg für die Gemeinnützige Hertie-Stiftung

