
Interview mit Dr. Deborah Kronenberg-Versteeg, Februar 2023
Forschung braucht starke Frauen.
Noch immer liegt der weltweite Frauenanteil in Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei unter 30 Prozent. Dr. Deborah Kronenberg-Versteeg (39) leitet die Unit Gliabiologie in der Abteilung Zellbiologie Neurologischer Erkrankungen am Hertie-Institut für klinische Hirnforschung (HIH) in Tübingen und ist Mutter zweier Kinder. Für ihre gerade angelaufene Studie zur Alterung von Gehirnzellen konnte sich die Neurobiologin eine Förderung über 1,6 Millionen US-Dollar von der Chan Zuckerberg Initiative sichern.
Was geht Ihnen zum Internationalen Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft durch den Kopf? Gab es Hürden, die Sie auf Ihrem Karriereweg meistern mussten?
Gleichstellung und Diversität sind wichtige Themen, die allgegenwärtig sind, nicht nur in der akademischen Forschung. Ich sehe tagtäglich, dass Frauen unterrepräsentiert sind in Führungspositionen, in der Wissenschaft vor allem in professoralen Positionen. In der medizinischen Forschung gibt es überproportional viele Doktorandinnen, aber dann fällt die Kurve steil ab. Es ist eben immer noch eine Herausforderung, eine akademische Karriere für Frauen attraktiv zu machen. Gerade in der Postdoc-Phase, die häufig durch Ketten-Kurzzeitverträge geprägt ist, stehen viele Frauen vor der Frage der Familienplanung. Wenn dann die berufliche Sicherheit fehlt, schreckt es viele von ihnen ab, ihren akademischen Weg weiter zu verfolgen.
Kinderbetreuung ist nach wie vor auch ein wichtiges Thema und aktuell wieder besonders brisant. Den Mangel an adäquaten Betreuungsangeboten spüren wir gerade ganz konkret bei uns zu Hause. Unser Sohn, acht, und unsere Tochter, fünf Jahre alt, sind in England geboren, wo es sehr viel flexiblere Möglichkeiten der Kinderbetreuung gab als in Deutschland. Es wäre wünschenswert, wenn Arbeitgeber hier noch mehr Verantwortung übernehmen würden und zum Beispiel mit flexiblen Kinderbetreuungsangeboten eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglichten. Es ist sehr viel Leidenschaft und Energie notwendig, immer weiter dranzubleiben und zu versuchen, sowohl der Familie als auch dem Beruf gerecht zu werden. Mir war und ist die Freude an meiner Arbeit immer ein besonderer Antrieb, auch wenn es zeitweise recht anstrengend ist. Ich selbst hatte außerdem das Glück, dass ich schon in meinem Studium in Göttingen und auch später von starken Frauen und Mentorinnen umgeben war, die diesen Weg bereits gegangen waren. Dieses Mentoring hat mir sehr geholfen, auch, als ich später schwanger wurde und mir ein beiläufiger Kommentar einmal den Boden unter den Füßen weggezogen hat, übrigens von einer Frau.
Grundsätzlich braucht es viel Organisation und Flexibilität, um alles hinzubekommen. Darüber hinaus braucht es Vorgesetzte, die einem einen gewissen Raum geben, flexibel arbeiten zu können. Aber das Gefühl, zeitlich weder meiner Familie noch meiner Arbeit gerecht zu werden, ist allgegenwärtig.
Was war passiert?
Ich war gerade wenige Monate schwanger mit meiner Tochter: Eine Professorin, die das nicht wusste, meinte: „Ein zweites Kind wird Deine Karriere killen.“ Ich war zunächst schockiert, habe dann aber so viel Trotz und Kraft entwickelt, dass ich nur gedacht habe: „Jetzt erst recht!“ Mit dieser Haltung bin ich dann meinen Weg gegangen.
Wie vereinbaren Sie heute Familie und Beruf? Welche Herausforderungen gab oder gibt es?
Das ist bis heute ein Kraftakt und ein großer Spagat, der gemeistert werden muss. Mein Mann und ich haben uns bisher ermöglicht, jeweils eine eigene Karriere zu haben, aber das bedeutet auch, viele Kompromisse einzugehen: Mein Mann ist zum Beispiel damals mit mir nach London und Cambridge gegangen, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe. Dann bekam er ein sehr gutes Job-Angebot in Stuttgart. Ich war einige Monate mit den Kindern allein in England, bis ich dann ein Fellowship bekam, um nach Tübingen zu kommen. Das war keine leichte Zeit! Und auch heute sitzen wir jeden Sonntagabend zusammen, um unsere Woche zu planen. Unser Interview kann ich jetzt beispielsweise nur führen, weil mein Partner unsere Tochter betreut, die mit Magen-Darm im Bett liegt. Dabei sollte er jetzt eigentlich schon auf Geschäftsreise sein. Da ist er mir wirklich eine große Stütze. Grundsätzlich braucht es viel Organisation und Flexibilität, um alles hinzubekommen, manchmal muss mein Mann zurückstecken, manchmal ich. Darüber hinaus braucht es Vorgesetzte, die einem einen gewissen Raum geben, flexibel arbeiten zu können. Aber das Gefühl, zeitlich weder meiner Familie noch meiner Arbeit gerecht zu werden, ist allgegenwärtig.
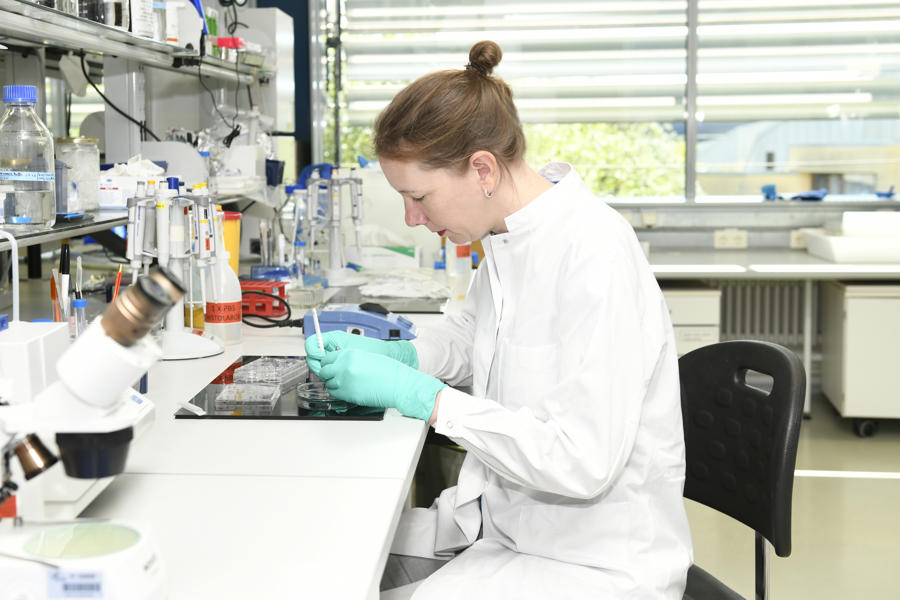
Sie leiten am HIH die Unit Gliabiologie. Was machen Sie dort genau?
Wir betreiben Grundlagenforschung und versuchen, den Alterungsprozess auf zellulärer Ebene zu verstehen und somit die Prozesse, die bei altersbedingten neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson ablaufen. Vor allem sind wir an Gliazellen interessiert; das sind Immunzellen im Gehirn, die rings um die Nervenzellen angeordnet sind, und diese mit Nährstoffen versorgen. Weitgehend unklar ist nur, welche Rolle die Gliazellen bei altersbedingten neurodegenerativen Erkrankungen spielen. Bisher hat sich die Forschung vorwiegend auf die Nervenzellen im Hirn fokussiert, weil sie im Verlauf der Erkrankungen absterben. Allerdings sieht man in den Mikrogliazellen während des Alterungsprozesses sehr viel mehr Veränderungen als in den Nervenzellen. Außerdem weiß man, dass genetische Risikofaktoren für die Alzheimererkrankung vorwiegend in den Gliazellen zu finden sind. Unsere Hypothese ist, dass Gliazellen stärker dazu beitragen, dass die Nervenzellen absterben, als bisher angenommen. Das wollen wir herausfinden.
Sie haben für einen weltweit einzigartigen Forschungsansatz 1,6 Millionen US-Dollar erhalten: Sie lassen menschliches Hirngewebe in der Petrischale gezielt erkranken, um die Prozesse live zu beobachten. Was steckt dahinter?
Wir wollen verstehen, warum es neurodegenerative Prozesse in altem Hirngewebe gibt, aber nicht in jungem Gewebe. Dafür arbeiten wir mit gesundem Hirngewebe, das uns von Patientinnen und Patienten unterschiedlichen Alters freiwillig gespendet wird. Das Gewebe wird üblicherweise bei einer Tumor-OP oder bei der Entfernung eines Epilepsieherdes entfernt und entsorgt, weil es dem Operateur den Weg versperrt. Das Besondere ist, dass das Gewebe im Inkubator noch eine Zeitlang „weiterlebt“, weil die zellulären Prozesse weiterlaufen. Im Labor lassen wir hauchdünne Schnitte des jungen und alten Gewebes in der Petrischale dann gezielt erkranken, indem wir es mit sogenannten Seeds beträufeln. Das sind Klümpchen falsch gefalteter Eiweiße, die in Nervenzellen krankhafte Veränderungen hervorrufen, an deren Ende eine neurodegenerative Erkrankung wie Alzheimer oder Parkinson steht. Dann beginnt die spannendste Phase: Wir können live mitverfolgen, wie das Gewebe auf diesen Einfluss reagiert. Bilden sich Ablagerungen? Wie schnell geht das? Kann junges Gewebe die falsch gefalteten Eiweiße besser abbauen als altes Gewebe? Wir können im Detail auf molekularer und zellulärer Ebene sehen, welche Faktoren im Erkrankungsprozess in den Nerven- und Gliazellen eine Rolle spielen.
Das Hertie-Institut für klinische Hirnforschung (HIH) in Tübingen ist eines der bundesweit größten und modernsten Zentren zur Erforschung neurologischer Erkrankungen. Das HIH ist ein modellhaftes Forschungszentrum im Zusammenspiel öffentlicher Ressourcen und privater Stiftungsmittel: Es wurde 2001 von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, dem Land Baden-Württemberg, der Eberhard Karls Universität Tübingen, ihrer medizinischen Fakultät sowie dem Universitätsklinikum Tübingen gegründet und 2004 eröffnet.
Die Methode ist weltweit einzigartig, wie sind Sie darauf gekommen?
Die Methode selbst wurde von meinen Kollaborationspartnern Dr. Thomas Wuttke vom HIH und Dr. Henner Koch vom Uniklinikum Aachen, der früher auch am HIH war, etabliert und vorangetrieben. Beide kommen aus der Epileptologie. Als ich vor vier Jahren aus Cambridge nach Tübingen wechselte, waren mein Steckenpferd die Immunzellen im Gehirn. An einem Freitagnachmittag hatten wir dann die verrückte Idee, mal zu sehen, was dabei rumkommt, wenn wir unsere Expertisen zusammenschmeißen. Wir machten gleich ein Experiment, und es war wirklich ein Aha-Moment, weil da richtig coole Ergebnisse rauskamen. Die Sache mussten wir natürlich weiterverfolgen.
Sie bekommen die Gewebeproben direkt aus der Klinik. Wie empfinden Sie die Zusammenarbeit?
Wir stehen selbst mit im OP, wenn die Proben entnommen werden, und dann gehen sie sofort ins Labor. Für uns ist das immer ein sehr aufregender Moment, und ich bin jedes Mal begeistert von der hochprofessionellen Zusammenarbeit. Wir sitzen im HIH direkt gegenüber vom Klinikgebäude und sind in wenigen hundert Metern im OP. Dieses Zusammenspiel zwischen Klinik und Forschung zeichnet Tübingen und insbesondere das HIH wirklich aus. Es gibt die Clinician Scientists und viele unserer Direktoren haben einen klinischen Background. Das ist für mich als reine Grundlagenforscherin sehr bereichernd. Dadurch habe ich die Anbindung an die Klinik und bin nah am Menschen. Mir gefällt das sehr, und ich möchte auch nicht wieder weg.

Warum sind Sie Neurobiologin geworden?
Den Anstoß gab ein Erlebnis kurz vor dem Abitur: Eine Freundin konnte plötzlich nicht mehr laufen, fühlte sich ständig wackelig auf den Beinen. Ihr wurde zunächst vorgeworfen, sie würde sich vor den Klausuren drücken wollen, und auch in der Klinik sagte man ihr, ihre Symptome seien psychosomatisch. Am Tag der Entlassung kam dann ein junger Arzt und schickte meine Freundin ins CT: Sie hatte eine Hirnblutung! Mich hat die Diagnose trotz des Schreckens irgendwie fasziniert, und ich dachte mir: „Was muss bloß im Hirn passiert sein, dass die Beine die Kontrolle verlieren? So ein Gehirn kann schon ziemlich spannend sein.“ Ich habe dann in Göttingen Molekulare Medizin und in Rotterdam klinische Epidemiologie studiert, in London in der Immunologie promoviert und kam in Cambridge dann dahin zurück, wo mein Herz war: zur Hirnforschung mit Fokus auf Immunzellen.
Welche Ziele haben Sie - vielleicht auch als Frau in der Wissenschaft?
Ich möchte die Studentinnen und Doktorandinnen, die ich betreue, ermutigen und inspirieren, ihnen aufzeigen, dass akademische Forschung genauso gut ein Weg für Frauen ist. Natürlich gehört ein bisschen Durchsetzungsvermögen und manchmal auch ein dickes Fell dazu, aber dieser Weg ist möglich. Mein Rat an Mädchen und junge Frauen wäre: „Vernetzt euch, unterstützt euch, sucht euch Gleichgesinnte, Vorbilder, Mentoren und Mentorinnen und lasst euch nicht von eurem Ziel abbringen. Stellt Forderungen gegenüber den Arbeitgebern und lasst das Thema Gleichberechtigung nicht müde werden.“ Für mich ist die Forschung eine große Freude, dieses Entdecken und Ergründen, die Freitagnachmittag-Aha-Momente und das Glücksgefühl, wenn es uns gelingt, das Gehirn wieder etwas besser zu verstehen. Ich würde nie etwas anderes machen wollen.
Werden Sie Teil unserer Gemeinschaft – abonnieren Sie unseren Newsletter!
INFO Das Interview führte Rena Beeg für die Gemeinnützige Hertie-Stiftung



