
Interview mit Prof. Dr. Lisa Sevenich, September 2025
Wir wollen mit dem Immunsystem Hirntumore austricksen
Prof. Dr. Lisa Sevenich ist Leiterin der Forschungsgruppe „Experimentelle Neuroonco-Immunologie“ am Hertie-Institut für klinische Hirnforschung (HIH) in Tübingen. Ihre Arbeitsgruppe ist Teil des Exzellenzclusters iFIT, dessen Förderung für weitere sieben Jahre verlängert wurde. Im Interview erklärt sie, wie eng Immun- und Nervensystem miteinander verflochten sind, welche Rolle die Immunologie im Kampf gegen Hirntumoren spielt, weshalb die Forschung zu Hirnmetastasen so lange vernachlässigt wurde – und warum gerade das Mikrobiom neue Hoffnung für zukünftige Therapien weckt.
Welche Rolle spielt unser Immunsystem bei der Entstehung von Hirntumoren und Hirnmetastasen? Ein spannendes Feld, mit dem sich Prof. Dr. Lisa Sevenich, Leiterin der Forschungsgruppe „Experimentelle Neuroonco-Immunologie“ am Hertie-Institut für klinische Hirnforschung (HIH) in Tübingen beschäftigt. Die Gruppe ist am iFIT-Exzellenzcluster beteiligt, der nun für weitere sieben Jahre gefördert wird. Warum die Immunologie bei der Bekämpfung von Hirntumoren immer stärker in den Fokus rückt, wieso Hirnmetastasen so lange von der Forschung ignoriert wurden – und warum das Mikrobiom ein vielversprechender Therapieansatz sein könnte, erzählt Prof. Lisa Sevenich in unserem Interview.
"Unser Ziel ist es, diese Interaktion der Tumorzellen mit dem Immunsystem so zu stören, dass das Immunsystem weiterhin seine eigentliche Aufgabe erfüllt."
Herzlichen Glückwunsch! Der iFIT-Exzellenzcluster in Tübingen, an dem Sie mit Ihrer HIH-Forschungsgruppe „Experimentelle Neuroonco-Immunologie“ beteiligt sind, wird für weitere sieben Jahre von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Zunächst: Was ist Neuroonco-Immunologie und womit beschäftigen Sie sich genau?
Die Neuroonco-Immunologie beschäftigt sich mit der Schnittstelle zwischen dem Nervensystem, dem Immunsystem und Krebserkrankungen des Nervensystems. Genauer gesagt, untersucht dieses Fachgebiet, wie das Immunsystem auf Hirntumore reagiert, und wie diese Interaktion für die Behandlung von Hirntumoren genutzt werden kann. In meiner Forschungsgruppe betreiben wir Grundlagenforschung und gehen konkret der Frage nach, wie Tumorzellen in Hirntumoren zellulär interagieren. Wobei wir unter Hirntumoren primäre Hirntumoren wie das Glioblastom verstehen, aber auch Hirnmetastasen, die mein Forschungsschwerpunkt sind. Bei Hirnmetastasen entsteht der primäre Tumor nicht im Hirn, wie zum Beispiel bei Brustkrebs, Lungenkrebs oder dem Melanom. Unsere Untersuchungen umfassen verschiedene Felder: Zum einen die Interaktion mit Zellen des Gehirns selbst, und mit der Frage: Wie bauen Immunzellen, die in diese Hirntumore eindringen, zunächst eine mögliche Antitumor-Immunität auf – aber verlieren diese dann wieder und unterstützen den Tumor am Ende sogar? Denn normalerweise sind die Immunzellen, die dann mit dem Tumor agieren, eher vom Hirn ausgeschlossen.
Die Immunzellen sind vom Hirn ausgeschlossen – wie muss man sich das vorstellen?
Wenn wir uns das Immunsystem im Körper anschauen, haben wir das angeborene und das erworbene Immunsystem, die im Zusammenspiel zum Beispiel Krankheitserreger aber auch Tumorzellen erkennen und abtöten können. Das Hirn ist von der Immunüberwachung des restlichen Körpers abgeschlossen. Es ist ein sehr empfindliches Organ und jede Art der Entzündung kann furchtbare Folgen für die Neuronen und die gesamte Hirnfunktion haben. Deshalb gibt es die Blut-Hirn-Schranke, eine dichte Barriere an den Gefäßen, die verhindert, dass Immunzellen in das Gehirn infiltrieren. Natürlich gibt es eine Immunüberwachung im Gehirn, die ist aber sehr spezifisch.
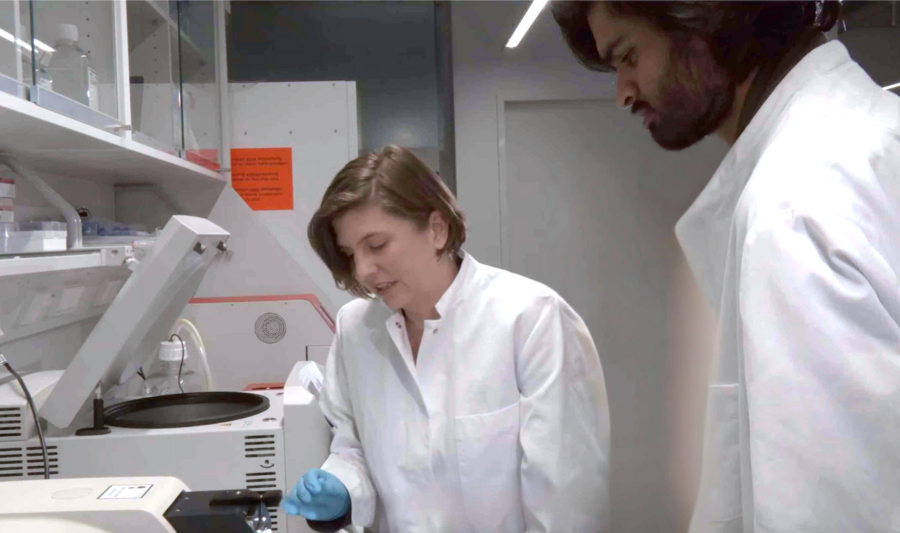
Das Hirn hat also einen eigenen Immun-Abwehr-Trupp…
Ja, das sind die sogenannten Mikroglia, spezielle Immunzellen des Gehirns. Lange Zeit dachte man, dass sie das Hirn effektiv schützen. Heutzutage haben wir viele neue Techniken, um uns die Zellzusammensetzung in unterschiedlichen Bereichen des Gehirns anzuschauen, und wir haben herausgefunden: In den Hirntumoren werden Immunreaktionen gegen den Tumor sehr schnell abgeschwächt. Jede Reaktion, die der Körper versucht, um diesen Tumor zu bekämpfen, wird sofort unterbunden.
Von dem eigenen Hirn-Immun-Abwehr-Trupp?
Genau! Mikroglia schaffen es nicht, den Tumor wie erhofft anzugreifen, sondern helfen ihm sogar. Sie werden von den Tumorzellen so manipuliert, dass sie ihre eigentliche Schutzfunktion verlieren. Ein Trick des Tumors. Wir versuchen zu verstehen, wie dieser „Seitenwechsel“ zustande kommt, und wie wir das Immunsystem so beeinflussen können, dass es den Tumor wieder bekämpft. Unser Ziel ist es, diese Interaktion der Tumorzellen mit dem Immunsystem so zu stören, dass das Immunsystem weiterhin seine eigentliche Aufgabe erfüllt, oder dass wir eben eine Umgebung generieren oder formen können, die den Immunzellen hilft, weiterhin ihre Aufgaben zu erfüllen. Wir wollen also den Tumor mit Hilfe des Immunsystems ebenfalls austricksen.
Wie gehen Sie dabei praktisch vor?
Wir nutzen unterschiedliche Modellsysteme, um diese Interaktionen nachzustellen, zu analysieren und zu stören. Weil wir einzelne Zellen nicht isoliert manipulieren können, brauchen wir einen ganzheitlichen Ansatz. Also versuchen wir, molekulare Schalter zu finden, die es uns erlauben, so ein immununterdrücktes Milieu in ein Milieu zu überführen, in dem Immunantworten stattfinden können. Dabei helfen uns Analysen von Patientenproben und der enge Austausch mit Klinikern oder forschenden Ärztinnen und Ärzten. Langfristig könnten daraus Strategien entstehen, die in klinischen Studien getestet werden.
"Wenn wir wüssten, welche Zusammensetzungen des Mikrobioms eine Hirnmetastasierung verhindern oder begünstigen, könnten wir gezielt eingreifen."
Eine vollständige Heilung bei Hirnmetastasen ist oft nicht möglich. Die personalisierte Medizin, bei der die Therapie auf die individuell genetischen Eigenschaften eines Tumors zugeschnitten ist, gilt gerade in der Krebstherapie als Hoffnungsträger. Wie sieht die Entwicklung hier aus?
Es ist ein großes Problem, dass wir über Hirnmetastasen noch viel zu wenig wissen. Das Forschungsfeld ist komplett unterrepräsentiert, und bis wir wirklich eine personalisierte Medizin anbieten können, ist noch viel Forschung nötig. Etwa zehn bis 20 Prozent aller Patientinnen und Patienten mit soliden Tumoren entwickeln Hirnmetastasen und wir haben fast nichts in der Hand, um zu helfen. Unser Anliegen ist, durch Grundlagenforschung zu verstehen, welche genetischen Muster zu bestimmten Mutationen führen und wie sich diese gezielt behandeln lassen. Im Vergleich zu anderen Erkrankungen stehen wir da noch am Anfang.
Woran liegt das?
Hirnmetastasen gehören keinem klaren Fachgebiet an – sie entstehen aus unterschiedlichsten Tumorarten und fallen oft „durch die Ritzen“. Lange Zeit waren sie sogar ein Ausschlusskriterium für klinische Studien, weil sie eher für das Endstadium stehen. Auch präklinisch gab es kaum gute Modelle, um sie zu erforschen. Das ändert sich gerade: Mehr Gruppen arbeiten daran, mehr Patientenproben werden untersucht. Aber bis die Ergebnisse Patientinnen und Patienten direkt zugutekommen, dauert es. Dafür braucht es solide Grundlagenforschung und gezielte Förderung. Die Notwendigkeit ist auf jeden Fall da, das habe ich im Verlauf meiner Karriere immer wieder gesehen. Deshalb forsche ich heute auch auf diesem Gebiet. Zum Glück findet inzwischen ein Wandel statt. Auch, um die Rolle des Immunsystems in diesem Zusammenhang besser zu sehen und zu verstehen.
Das Mikrobiom soll auch Einfluss auf die Entstehung von Hirnmetastasen haben…
Das ist ein unglaublich spannendes Feld. Ich bin gleichzeitig am HIH und am M3 Forschungszentrum in Tübingen tätig. Dieses M3 steht für Malignome, Metabolome, Microbiome – und genau das ist dort der Forschungsschwerpunkt. Wir wissen aus unserer Arbeit, dass ein durch Antibiotika geschädigtes Mikrobiom die Hirnmetastasierung beeinflussen kann. Das geschieht vor allem über Effekte auf die Immunzellen. Ein zentrales Stichwort ist hier die Darm-Hirn-Achse, und man weiß inzwischen, dass Immunzellen durch mikrobielle Metaboliten, also Stoffwechselprodukte, beeinflusst werden.
Hertie Institut für klinische Hirnforschung
Das Hertie-Institut für klinische Hirnforschung (HIH) bildet mit der Neurologischen Universitätsklinik Tübingen das Hertie-Zentrum für Neurologie, eine der größten und modernsten Einrichtungen für klinische Hirnforschung bundesweit. Um die Einheit von Forschung und Patientenversorgung zu betonen, wurde das Zentrum für Neurologie 2023 in „Hertie-Zentrum für Neurologie“ umbenannt.
Ließe sich dann durch eine gezielte Ernährung, die das Mikrobiom positiv beeinflusst, möglicherweise die Entstehung von Hirnmetastasen künftig beeinflussen?
Das ist tatsächlich eine der Richtungen, in die wir gehen wollen. Bisher konzentrieren wir uns stark auf die Behandlung bestehender Krebserkrankungen. Wenn wir allerdings wüssten, welche Zusammensetzungen des Mikrobioms eine Hirnmetastasierung verhindern oder begünstigen, könnten wir gezielt eingreifen – vielleicht sogar präventiv. Das wäre ein riesiger Schritt nach vorn. Interessant ist auch, dass es bestimmte Bakterien gibt, die Vorläufer von Neurotransmittern, also Botenstoffen im Gehirn produzieren. Eine sehr interessante Frage dazu wäre meiner Ansicht nach: Gibt es bestimmte Kompositionen des Mikrobioms, die Tumorzellen vorab darauf vorbereiten, im Hirn gut zu wachsen? Wenn man so was dann verändern könnte, wäre das ein riesiger Durchbruch.
Der iFIT-Exzellenzcluster konzentriert sich auf die Entwicklung und Anwendung von Bildgebungsverfahren und funktionellen Analysen, um maßgeschneiderte Therapien für Krebserkrankungen zu ermöglichen. Worin besteht die Brücke zu Ihrer Arbeit?
Bildgebung ist in unserer Forschung zentral – vom MRT zur Analyse des Tumorwachstums bis zur hochauflösenden Mikroskopie. Viele unserer Analysen betrachten bisher nur einzelne Zeitpunkte. Spannend wäre es, mit moderner Bildgebung Krankheitsverläufe und Immunreaktionen über längere Zeit sichtbar zu machen. So könnten wir sehen, wann eine Therapie anspricht oder nachlässt, und rechtzeitig therapeutisch eingreifen. Besonders wichtig wäre es, eine Immunantwort in Echtzeit zu erkennen. Genau hier ergänzt sich unsere Arbeit mit den Zielen von iFIT.
Welche Voraussetzungen bietet Ihnen das HIH für Ihre Arbeit?
Das HIH bietet für meine Forschung exzellente Bedingungen. Das war auch der Grund, warum ich nach Tübingen gewechselt bin. Hier habe ich die direkte Interaktion mit Neurowissenschaftlern, die klinische Anbindung und den Austausch mit forschenden Ärztinnen und Ärzten. Während meiner gesamten Karriere war es für mich immer wichtig, an dieser Schnittstelle zu arbeiten. Ich habe tatsächlich sehr grundlagenbasiert angefangen, aber mir hat bisher immer dieser Grund gefehlt, weshalb ich das mache. Wir selbst haben zwar keinen Patientenkontakt, aber wir haben Kontakt zu den Klinikern, so dass man im engen Austausch diskutieren kann. Wir versuchen nun im großen Maßstab, Patientengruppen zu analysieren und eine solide Grundlage zu legen.
Sie „brennen“ richtig für Ihre Forschung, oder?
Ja, absolut. Als Immunologin fasziniert mich das Zusammenspiel von Immun- und Nervensystem. Und es ist mir eine persönliche Mission, etwas gegen Hirntumoren und Hirnmetastasen zu tun. Grundlagenforschung ist der Schlüssel, um langfristig den Patientinnen und Patienten zu helfen.
INFO Das Interview führte Rena Beeg für die Gemeinnützige Hertie-Stiftung



